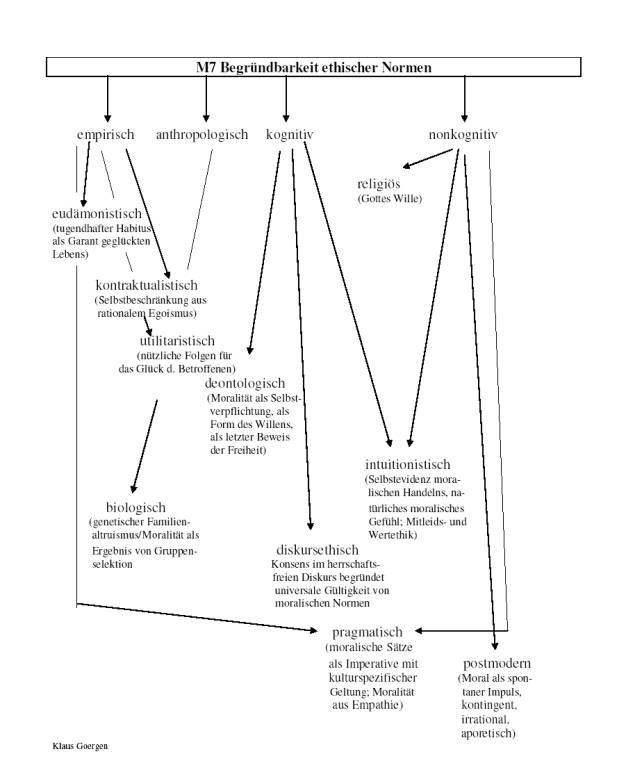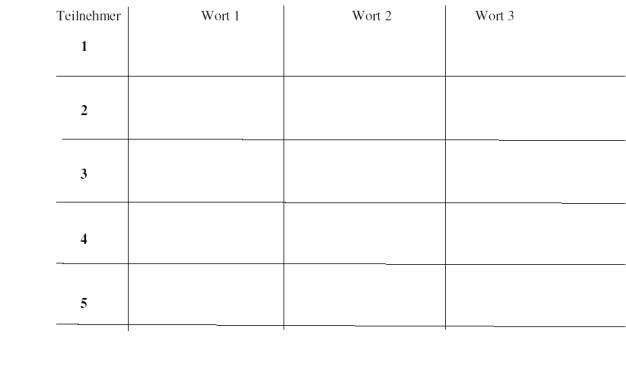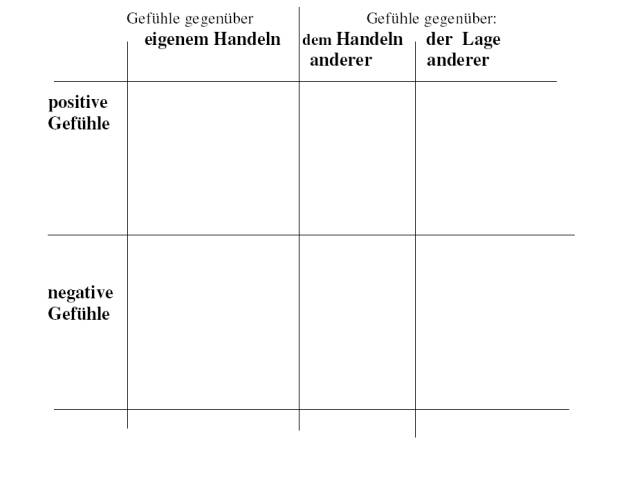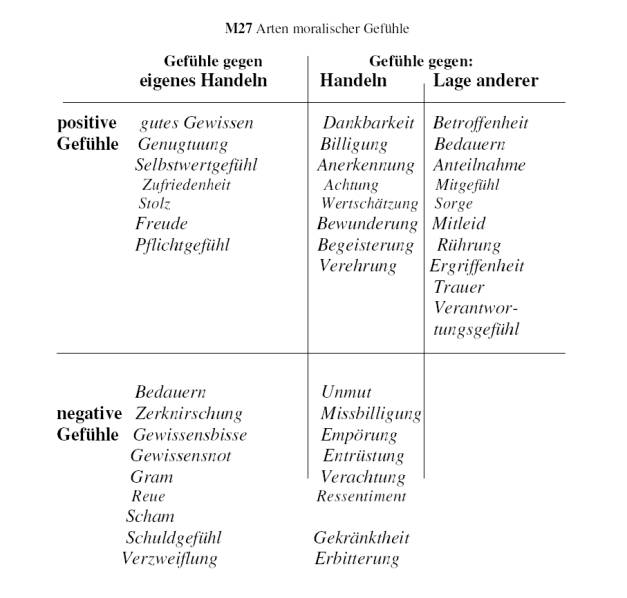|
Klaus
Goergen Wie
wird Moral begründet? Inhalt: 1.
Vormerkungen, Literatur, Überblick über Materialien 2.
Zur Einführung: "Eine kurze Geschichte der Moralbegründungen"
3.
Übungstexte zu den Grenzen des Utilitarismus 4.
Materialien zu Einstieg, Überblick und Problematisierung 5.
Materialien zum Kontraktualismus 6.
Materialien zur Diskursethik 7.
Materialien zur postmodernen Ethik 8.
Materialien zu moralischen Gefühlen Anders
als im bisherigen Lehrplan, der die Einführungen in die philosophische Ethik
nach personalen, historischen und Ansatz spezifischen Gesichtspunkten gliederte
und auf drei Schuljahre verteilte, konzentriert der neue Lehrplan die
Fragestellung auf die Moralbegründung im systematischen und engeren Sinne. Im
Zentrum steht somit die Frage nach den verschiedenen empirischen,
anthropologischen, kognitiven und nonkognitiven Fundierungen von Moral. Die
Fokussierung auf die Begründungsfrage – und dabei sind alle gängigen
'Kandidaten': Gott, die Natur, die Vernunft, der Wille, das Glück, die Sprache,
die Empathie im Unterricht behandelbar – ermöglicht eine für Schüler
relevante, durchsichtige und einheitliche Fragestellung in der Lehrplaneinheit.
Zudem können klassische und aktuellere Ansätze der Moralbegründung im
unmittelbaren Kontrast oder in ihrer Fortentwicklung thematisiert werden. Literaturempfehlungen
– wissenschaftliche Literatur Die
folgenden Hinweise konzentrieren sich auf neuere Arbeiten, die entweder die
Frage nach der Moralbegründung
insgesamt thematisieren oder die einzelne aktuellere Ansätze der Moralbegründung enthalten.
Die Literaturhinweise zur LPE 8 im Anhang des Lehrplans benennen Standardwerke
auch zu den klassischen Ansätzen. -
Kurt Bayertz, Hrsg., Warum moralisch sein?, Paderborn 2002. (Der
Sammelband stellt, nach einer Einleitung, die einen knappen analytischen Überblick
über Fundierungsansätze bietet, historische
und aktuelle Texte zusammen, die Moralbegründungen aus deontologischer,
kontraktualistischer, utilitaristischer und pragmatischer Perspektive bieten.
Die skeptischen Positionen kommen dabei ausgiebig zu Wort. Das Spektrum reicht
von Platon über Apel und Hare bis Bernard Gert (1998) -
Marcus Düwell, Christoph Hübenthal, Micha H. Werner, Hrsg, Handbuch Ethik,
Metzler- Verlag,
Stuttgart, Weimar 2002. S. 1-242. (Das
Handbuch bietet im ersten Teil einen fundierten Überblick über metaethische
und normativ-ethische Theorien von Aristoteles
bis Gadamer. Die einzelnen Essays zu den teleologischen und deontologischen Ansätzen
sind mit ausführlichen Literaturhinweisen
versehen. Der Schwerpunkt liegt bei den kognitivistischen Ansätzen, der angelsächsische
Pragmatismus und
die französischen Postmodernen bleiben weitgehend ausgeblendet. Dennoch bietet
dieses Handbuch bislang die konzentrierteste
Einführung in Fragen der Moralbegründung.) -
Konrad Ott, Moralbegründungen zur Einführung, Junius-Verlag, Hamburg 2001. (Diese
Monographie bietet in fünf Kapiteln Einführungen in die Kantische Ethik, den
Utilitarismus, den Kontraktualismus, den modernen deontologischen Ansatz von A.
Gewirth sowie die Diskursethik. In drei einführenden Kapiteln werden allgemeine
Fragen der Moralbegründung und –begründbarkeit angesprochen. Die Arbeit
argumentiert streng formalistisch und rationalistisch, der Autor bekennt sich
abschließend zur epistemischen Überlegenheit der Diskursethik über andere
normative Ansätze.) -
Ernst Tugendhat,
Aufsätze 1992-2000, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/M. 2001. (In
zwei Aufsätzen: "Was heißt es, moralische Urteile zu begründen" (S.
91-108) und "Wie sollen wir Moral verstehen" (S. 163-184)
diskutiert Tugendhat Möglichkeiten und Grenzen der Moralbegründung und
entwickelt sein eigenes Konzept eines "symmetrischen Kontraktualismus") -
Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/M. 1993. (Die
Vorlesungen behandeln und kritisieren unter vernunftkritischen Aspekt u.a. die
klassischen Ansätze von Kant, Schopenhauer,
Aristoteles sowie den Kommunitarismus MacIntyres und die Diskursethik. Die
Vorlesung über die Diskursethik
enthält Tugendhats bekannte Einwände gegen diesen Ansatz.) -
Zygmunt Bauman, Postmoderne Ethik, Hamburger Editionen, Hamburg 1995. (Die
einzige Monographie zur postmodernen Ethik, die deren Prämissen und Prinzipien
in leicht verständlicher Sprache im Überblick
darstellt. In der Einleitung werden die Grundpositionen postmoderner Ethikkritik
und Moralbegründung in sieben Thesen knapp zusammengefasst.
Erkenntnistheoretisch orientiert sich die Arbeit an den Schriften von E. Lévinas.) -
Jean-Francois
Lyotard, Postmoderne Moralitäten, Passagen-Verlag, Wien 1993. (Die
Aufsatzsammlung enthält Bruchstücke der postmodernen Ethik Lyotards.
Insbesondere der Abschnitt über "Systemphantasien"
(S. 65-104) lässt die kritische Position des Autors zu gängigen Moralbegründungen
erkennen.) -
Emmanuel Lévinas, Ethik und Unendliches, Edition Passagen, Wien 1996. (Im
Gespräch mit Ph. Nemo entwickelt Lévinas seine Moralbegründung aus der
Verantwortung für den Anderen: Die eigene Subjektivität, die Selbstfindung ist
erst in der völligen Selbstlosigkeit und der Hinwendung zum Anderen zu
erlangen, S. 64-79) -
Richard Rorty, Wahrheit und Fortschritt, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/M. 2000. (Im
zweiten Teil der Arbeit "Moralischer Fortschritt: Für integrativere
Gemeinschaften" (S. 241-354) stellt Rorty das pragmatische
Programm einer Moralbegründung in mehreren Schritten vor. Der Skeptizismus
gegenüber vernunftgestützten Fundierungsversuchen führt zum Bekenntnis einer
empathiegestützten Erweiterung von Loyalitäten zur Durchsetzung einer
Menschenrechtskultur durch sozialen Fortschritt) -
Wolfgang Kuhlmann, Sprachphilosophie, Hermeneutik, Ethik, Würzburg 1992. (Hier
wird eine "Begründung der Diskursethik" (S. 164-175) in leicht verständlicher
und konzentrierter Form geliefert, wie man
sie bei den Hauptvertretern Apel und Habermas nicht findet. Im vorhergehenden
Abschnitt des Buchs – "Ethik und Rationalität"
(s. 150-163) wird die Diskursethik in fünf Thesen anderen Begründungsansätzen
entgegengestellt. ) Literaturempfehlungen
– didaktische Literatur Die
klassischen Ansätze: antike eudaimonistische Ethik, der Kontraktualismus
Hobbes', der Utilitarismus Benthams und Mills, der Kantianismus sowie die
Schopenhauersche Mitleidsethik sind in den neueren Ethik-Schulbüchern gut
dokumentiert. Neben
dem dreibändigen Standardwerk des Stam-Verlags, dem Lehr- und Arbeitsbuch von
Schwoerbel, Frericks, Richter, Vollmar (Köln 1994) sind besonders die folgenden
Schulbücher für die Behandlung der Lehrplaneinheit zu empfehlen: -
Jörg Peters, Bernd Rolf: Ethik aktuell, Texte und Materialien zur Klassischen
und An- gewandten
Ethik, C.C. Buchner Verlag, Bamberg 2002. (Der
Band orientiert sich im ersten Teil - "Klassische Ethik" – eng an
der Fragestellung der Lehrplaneinheit, er enthält zahlreiche
originelle Texte und Beispiele sowie die verschiedensten methodischen Zugänge
zur Frage-stellung. Ein "Methodenüberblick"
ist vorangestellt. Auch die Diskursethik wird ausführlich dargestellt, am
Beispiel erläutert und kritisiert.) -
Eva Jelden, et. al, Projekt Leben. Ethik für die Oberstufe, Klett-Verlag,
Leipzig 2001. (Der
Band enthält im 4. Teil – "Grundpositionen ethischen
Argumentierens" – eine Darstellung der klassischen Ansätze von Sokrates
bis Schopenhauer sowie knappe Einführungen in aktuelle Ansätze: Diskursethik,
Kommunitarismus, Postmoderne) -
Hermann Nink, Hg, Standpunkte der Ethik, Schöningh-Verlag, Paderborn 2000. (Der
Band bietet im ersten Kapitel – "Grundlegung der Ethik" – unter
der Fragestellung: "Wie lässt sich Moral begründen?" (S.
49-125) Materialien zu den klassischen und modernen Begründungsansätzen.
Allerdings sind die Zusammenhänge nicht stets plausibel: Sokrates und Habermas
unter dem Aspekt der Diskursethik zu verbinden greift zu kurz.) -
Günther Bien, Hans Jürgen Busch, Grundpositionen philosophischer Ethik, 21
Arbeitsblätter mit
didaktisch-methodischen Kommentaren, Sekundarstufe II, Klett-Verlag, Stuttgart
1997. (Das
Materialienheft stellt historische und aktuelle Quellentexte zur Begründung von
Moral von Sokrates bis Habermas und von Hobbes bis Frankena zusammen, die als
Kopiervorlagen für den Unterricht gut geeignet sind. In einem didaktischen
Kommentar werden Fragestellungen und Arbeitsaufträge zu den Texten formuliert
und die Texte knapp erläutert. Der Schwerpunkt liegt allerdings bei den
klassischen Positionen.) -
Uwe Gerber et. al., Hg., ethisch urteilen, moralisch handeln, Materialien für
die Sekundarstufe II,
Diesterweg-Verlag, Frankfurt/M. 2002. ( Schülerband, 65 S., Lehrerband 16 S. ) (Die
beiden Hefte enthalten Materialien, Texte, Bilder, Karikaturen zu den Begründungsansätzen,
geeignet besonders für Einstiege
ins Thema. Der Schwerpunkt liegt auch hier bei den klassischen Ansätzen) -
Roland W. Henke, u.a., Zugänge zur Philosophie. Grundband für die Oberstufe,
Cornelsen- Verlag,
Berlin 2001³. (Der
dritte Abschnitt des Werks: "Probleme des menschlichen Handelns"
bietet auf 90 Seiten einen detaillierten und materialreichen
Überblick über klassische und neuere Ansätze von Aristoteles bis Habermas.) -
Ethik und
Unterricht (E&U) Heft 2, 1994: Diskursethik, Diesterweg, Frankfurt/M. 1994. (Eine
gute und leicht lesbare Einführung in die Diskursethik bietet K. Ott in diesem
Heft; für den Unterricht verwendbar ist der – anspruchsvolle – Versuch von
H. Thomas und H. Würger, eine diskursethische Letzt-begründungsdiskussion im
Unterricht zu führen. Die Unterrichtseinheit ist in diesem Heft dokumentiert.) Zu
den Materialien Den
Materialien für den Unterricht vorangestellt ist ein kurzer Überblick über
die Geschichte der Moralbegründungen. Da
alle klassischen Begründungsansätze gut dokumentiert sind, (s.: didaktische
Literatur) können sich die folgenden Materialien zur LPE 8 , mit einer
Ausnahme, die vorangestellt ist, auf vier Schwerpunkte beschränken: M1:
an vier Fällen
können in Kleingruppenarbeit Möglichkeiten und Grenzen utilitaristischer Argumentation
diskutiert werden. Die Beispielfälle sind sukzessiv so angelegt, dass ein
hedonistisches Kalkül immer weniger ethisch vertretbar ist. Das Arbeitsblatt
eignet sich als Übergang von einer utilitaristischen zu einer deontologischen
Argumentation. M2-M9
bieten
unterschiedlich schwierige Einstiegsvarianten in das Thema Moralbegründung. Die
Texte können alternativ oder auch – selektiv - ergänzend im Unterricht
verwendet werden. M10-M12
ermöglichen
eine Diskussion aktueller Ansätze des Kontraktualismus. Nach einem Einführungstext,
M8, finden sich zwei neuere Texte Tugendhats, M9, M10, die Vorzüge und Kritik
des Kontraktualismus aus heutiger Sicht darstellen. Die Texte können die
klassischen Texte zu Hobbes, Locke oder Rawls, die sich in allen Schulbüchern
finden, ergänzen. M13-M17
stellen, nach
einem Einleitungstext zur Diskursethik, Materialien zur Behandlung der Diskursethik
im Unterricht zusammen. M18-M23
stellen, nach
einem Einleitungstext zur postmodernen Ethik und einem Modell zu deren Quellen,
Materialien zur Darstellung und Kritik postmoderner bzw. pragmatischer Ethik im
Unterricht zusammen. M24-M27
sind Arbeitsblätter,
die als Einstiege zur Behandlung nonkognitiver Ansätze geeignet sind. Von
Hume und Schopenhauer bis zum Pragmatismus, der Care-Ethik oder dem
Neoaristotelismus bei M. Nussbaum spielen moralische Gefühle in zahlreichen
Begründungsansätzen eine zentrale Rolle. Für einen phänomenologischen
Einstieg in diese Ansätze bietet sich ein systematisierter Überblick über das
Spektrum moralischer Gefühle an. Dazu können M24
oder M25
alternativ
verwendet werden, um das Arbeitsblatt M26
dergestalt
ausfüllen zu lassen, wie es in M27 dargeboten wird. 2.
Eine kurze Geschichte der Moralbegründungen Moral,
das ist, wenn man moralisch ist. Versteht
Er? Es ist ein gutes Wort. (Georg
Büchner, Woyzeck) Was
die Gewalt für das Recht, das ist die Begründung für die Moral. Ihre Gültigkeit
ist ihre einzige Stütze, eine Moral,
die ihren Geltungsanspruch nicht begründen kann, darf auf Befolgung nicht
hoffen. Soweit sind sich (beinahe)
alle einig. Aber
fast alles, was mit der Begründung von Moral zu tun hat, ist umstritten: Ob
sie überhaupt begründet werden darf, kann, oder muss: Schon die schiere Frage:
'Warum soll ich moralisch sein?'
halten manche für verwerflich "schon im Zweifel liegt die Untat",
sagt Cicero dazu.1 Andere,
wie Prichard, halten die Frage für sinnlos, weil sie sich entweder zirkulär
beantwortet, oder falsche, weil außermoralische, Gründe angeführt werden.2
Wieder andere
halten sie für bedeutungslos, weil moralisches Verhalten
in praxi nicht von der Begründung von Moral abhängt. "Die Vorstellung,
dass es Jack the Ripper oder Adolf Hitler nur an guten Begründungen dafür
gefehlt hat, moralisch zu sein, ist ziemlich grotesk."3, sagt K. Bayertz. Umstritten
ist ferner, womit Moral begründet werden kann, - hier heißen die wichtigsten
Kandidaten: Gott, das Glück,
die Vernunft, Natur, Wille, Gefühl und Sprache. Umstritten ist schließlich, für
wen die Begründung gelten soll: für alle, wie die Universalisten oder für
einige, wie die Relativisten glauben. Nun
lassen sich die Moralbegründungen unter verschiedensten Aspekten betrachten.
Die 'deutsche' Betrachtungsweise,
die auch dem früheren Lehrplan zu Grunde lag, stellt eine Mischung aus
historischer, systematischer
und personenorientierter Abfolge dar: die antiken Glücksethiken stehen historisch
vor dem Kontraktualismus
Hobbes', der moderne Kommunitarismus rangiert systematisch vor der Diskursethik, Kants Ethik wird personenorientiert
nach jener J.S.
Mills betrachtet. Im Hintergrund ahnt man eine 'pyramidalische' Betrachtung,
ähnlich jener, wie sie lange Zeit dem Kanon deutscher Literaturgeschichte mehr
oder minder explizit zu Grunde lag: Alles strebt zu Goethe bzw. Kant hin, danach
geht es – literarisch bzw. ethisch – bergab. Aber
man muss, um ein Wort Nietzsches zu variieren, schon Deutscher sein, um zu
glauben, jene Moralbegründung
sei die beste, die uns am meisten fordert. Im Allgemeinen gelten eher jene Begründungen
für die
stärksten, die mit den schwächsten Prämissen am meisten erklären. Und
es sind auch ganz andere Betrachtungsweisen denkbar. In der angloamerikanischen
Tradition wird die Fundierungsdebatte
seit Mitte des 19. Jhds. unter dem Schlagwort 'why be moral?' geführt, die
Trennungslinie läuft hier eher zwischen den 'Glücksverächtern', Sokrates,
Kant, Schopenhauer, Nietzsche und den 'Glücksgönnern' , Aristoteles, Epikur,
Mill, Hare, Nussbaum. Oder
es wird danach unterschieden, wer durch die Moralbegründung überzeugt werden
soll: Der
reine Amoralist, der als 'Trittbrettfahrer' jede Moralbegründung akzeptiert,
solange sie von ihm selbst kein moralisches
Verhalten fordert; der "rationale Egoist", der einsieht, dass er von
anderen nur erwarten kann, was er selbst zu bieten bereit ist; oder der reine
Rationalist, der einsieht, dass es vernünftig ist, moralisch zu sein. Denkbar
wäre auch eine Aufteilung in Begründungen 'von innen' und 'von
außen'. Von
innen: Es gibt eine Kraft, eine Anlage, eine typisch menschliche Eigenheit,
etwas Ererbtes oder Erlerntes, die uns zu moralischem Verhalten disponieren.
Seien es Vernunft und freier Wille, bei Kant, Mitleidsfähigkeit oder
Achtsamkeit, bei Schopenhauer oder Carol Gilligan, Sprache als Verständigungsmittel,
bei Habermas und Apel, die Intuition von Werten, bei Scheler, die Fähigkeit zu
Phantasie und Liebe, bei Martha Nussbaum, das Geworfen-Sein in Verantwortung,
bei Sartre oder gar ein angeborener Altruismus, wie ihn die biologische
Anthropologie gelegentlich behauptet. Von
außen: Unsere Lage als gesellschaftliche Wesen, mit anderen,
unser Angewiesensein auf
andere, unsere moralische
Sozialisation durch
andere, unsere
Antizipation von Sanktionen durch ein bestimmtes Verhalten gegenüber
anderen, unser
Wunsch von anderen
respektiert und gut behandelt zu werden, nötigen uns zu moralischem
Verhalten. Solche Begründungen 'von außen' verbinden dann antike Tugendethik
und Kommunitarismus
mit dem Utilitarismus, dem Kontraktualismus, dem amerikanischen Pragmatismus und
einer postmodernen
'Ethik des Anderen' bei Lévinas. Die
Beispiele zeigen: verschiedene Darstellungsarten von Moralbegründungen lassen
sich begründen. Was
die Vermittlung von Moralbegründungen im Schulunterricht anbelangt, scheint es
sinnvoll, die didaktisch formulierte
Frage, "wie
wird Moral
begründet?" in einem engeren Sinne systematisch zu beantworten, d.h.,
nicht auch noch zu fragen: 'wann
und warum
hat wer
Moral begründet',
sondern sich wirklich auf jene Grundannahmen und Argumentationen zu
konzentrieren, in denen sich die Moralbegründungen unterscheiden. In
wissenschaftstheoretischer Hinsicht stehen Begründungsfragen sicher am Anfang
oder hinter allen
Einzelfragen von normativer oder angewandter Ethik; in didaktischer Hinsicht
sollten sie als eine Frage neben
anderen –
etwa jenen nach Gerechtigkeit oder Freiheit - behandelt werden. Im
dargelegten Sinne etwa lassen sich vier allgemeine Begründungsweisen
unterscheiden, empirische,
anthropologische, kognitive, non-kognitive, die ich in einem kurzen Überblick, darstellend und kritisierend,
in Erinnerung rufen möchte. Ich will damit den Rahmen dessen abstecken, was
eine Behandlung von Begründungsfragen im Unterricht leisten könnte. Die
älteste, manche sagen, die eigentliche, die einzig ehrliche und glaubwürdige
ist die religiöse
Moralbegründung. Sie
beruht auf doppelter Sanktion: Verheißung und Verdammnis: Himmel und Hölle,
Nirvana und Reinkarnation, je nach tugend- oder lasterhaftem Verhalten. Der
"Vater im Himmel" ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die erste
moralische Instanz, die Eltern, wird in den Himmel
verlängert, die moralischen Prädikate bleiben beim Gläubigen an ein Subjekt
gebunden. Das meint : Anthropomorphismus
von Moralität. Der
große Vorteil: die moralische Verpflichtung (und Begründung) ist
unhintergehbar im Über-Ich verankert, die transzendente Autorität erlaubt
keine Ausnahmen vom moralischen Handeln. "Der liebe Gott sieht alles"
– für Tilman Moser der schrecklichste Satz seines Lebens.4 Aber:
"Gott ist tot...Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder.
Aber wie haben wir das gemacht?
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen
Horizont wegzuwischen?
Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Gibt es noch ein
Oben und ein Unten? Irren
wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?..."5 -
Nietzsches apokalyptische Metaphorik zeigt: er weiß um die gewaltigen
moralischen Folgen des Verlusts von Religiosität,
sieht das moralische Vakuum, das der Tod Gottes zeitigt, und glaubt zugleich mit
dem Verlust einer jenseitigen Moralbegründung sei alle Moralbegründung
hoffnungslos. Das
begründungstheoretische Vakuum, das durch die fundamentale Religionskritik seit
dem 18. Jhd. in Europa entsteht,
wird nun, nicht zufällig im unmittelbaren Anschluss daran, von säkularen Begründungen
neu zu füllen versucht:
Benthams und Kants Fundierungen müssen auch auf dem Hintergrund der
Religionskritik ihrer Zeit gesehen
werden. Allerdings:
antike säkulare Ethiken haben einen anderen Ursprung: Man
kann sie als empirisch
begründet
bezeichnen, weil sie Moral als empirisches Mittel zu einem konkreten empirischen
Zweck verstehen: Glückseligkeit,
eudaimonia, ist
für das 'zoon politicon' nur erreichbar, wenn es sich in der Polis tugendhaft
verhält. Moral
wird in antiker Tugendethik als Garant geglückten Lebens in der Gemeinschaft
begründet. Die Bandbreite reicht von Zenon bis Epikur, je nachdem, welche Rolle
dem Glück im Verhältnis zur Tugend zugesprochen wird: Für
Platon und die Stoa gilt der Vorrang der Tugend, sie ist nicht nur notwendige,
sondern auch hinreichende Bedingung
für das Glück. Nur wer seine unmittelbaren Glücksbegierden in Askese und
Apathie zurückstellen kann, erlangt die höhere Glückseligkeit der Ataraxia,
der Unerschütterlichkeit. Epikur dreht das Verhältnis um: wer seinem –
allerdings wohldosierten, gemäßigten – Glücksverlangen nachgibt, der lebt
tugendhaft. Aristoteles gelangt zu einer mittleren Position durch die
Politisierung der Glücksverheißung: Das subjektive Glücksstreben ist erstes,
notwendiges, aber nicht hinreichendes Ziel für ein geglücktes Leben in der
Polis. Dazu bedarf es, wie uns die Vernunft sagt, der sittlichen Tugenden. Arete
und logos sind autonome Entitäten, aber sie bleiben auf das letzte Ziel des Glücks
ausgerichtet. Der
Kontraktualismus,
auf Hobbes zurückgehend,
kann als Bindeglied zwischen einer antiken Tugendethik und dem modernen
Utilitarismus verstanden werden. Auch er argumentiert empirisch. Moralisches
Verhalten begründet sich für den rationalen Egoisten aus der Notwendigkeit,
den Übeln des Naturzustands zu entrinnen. Weil ich von den Anderen erwarte,
dass sie sich an Normen halten, denn nur so ist mein Leben und Eigentum geschützt,
muss ich – notgedrungen – mich auch an diese Normen halten. Die gegenseitige
Verpflichtung wird im fiktiven Vertrag, dem Kontrakt, festgelegt. Bei Hobbes
schließen die Untertanen diesen Vertrag mit dem Herrscher, dem Leviathan, der
sich dafür verpflichtet, ihre Sicherheit zu schützen; im modernen
Kontraktualismus wird der Vertrag als wechselseitiger zwischen den souveränen Bürgern
verstanden. Ein aufgeklärter, symmetrischer Kontraktualismus gilt heute vielen
als letzte, verbliebene Fundierungsmöglichkeit von Moral, nachdem alle
Hoffnungen auf eine Begründung durch Vernunft, Natur und Empathie im Schwinden
sind. Aber der Kontraktualismus sieht sich mit vier Einwänden konfrontiert: -
der Mensch wird als individualistische Monade gesehen, losgelöst von allen, in
Wirklichkeit von klein auf anerzogenen,
sozialen Bezügen und Verpflichtungen. Die vorgestellte Situation: dass sich ein
Einzelner überlegen kann, ob er den Naturzustand verlassen will, und wenn ja,
unter welchen Bedingungen, entspricht nicht der Lage, in der sich reale Menschen
sozial vorfinden. -
der angenommene Egoismus übersieht den spontanen, auf Sympathie oder Empathie
beruhenden Altruismus. Dieser
nicht-normative Altruismus ist aber in Wirklichkeit Quelle der meisten
moralischen Handlungen. -
Damit eng verwandt ist der dritte Einwand. Der Kontraktualismus kann weder
Entstehung noch Wirkung des moralischen
Gewissens erklären, ohne sich selbst aufzuheben: wer eine innere Instanz
ausgeprägt hat – warum auch
immer – die ihm sagt, wie er sich moralisch zu verhalten hat, der braucht
keinen Kontrakt. -
Schließlich: der Kontraktualismus beantwortet nur die Frage: 'warum soll man
moralisch
sein?', nicht die Frage: 'warum soll ich
moralisch
sein?' Dem Egoisten wird als beste Möglichkeit jene erscheinen, in der sich
alle anderen an den Kontrakt halten, nur er selbst nicht. Das Problem des
moralischen 'Trittbrettfahrers' ist innerhalb des Kontraktualismus nicht zu lösen. Auch
der Utilitarismus
argumentiert
im einzelnen anders als die antike Tugendethik: -
er hat keinen Apriori-Begriff des Guten oder Gerechten. -
er kennt keine Universalien: "Menschenrechte sind Unsinn auf Stelzen"
sagt Bentham. -
nur Lustmaximierung und Unlustvermeidung gelten als Handlungszwecke. -
Der größte Vorteil gegenüber den antiken Tugendethiken liegt darin, dass die
Begründung auf eine einzige, unmittelbar
evidente, mit der Natur des Menschen zweifelsfrei vereinbare Größe, das
Luststreben, reduziert wird. Damit scheinen die Probleme des Intuitionismus und
Relativismus behoben. Dennoch:
verbunden mit antiker Glücksethik wie dem Kontraktualismus bleibt der
Utilitarismus über die konkrete Zweckbezogenheit (telos) von moralischem
Handeln. Der
Utilitarismus begründet Moralität mit den nützlichen Folgen von Handlungen.
Was gut ist, erweist sich somit erst a posteriori: wenn es dem größeren Glück
einer größeren Zahl dient. Das Problem, subjektive und allgemeine Glückssteigerung
in Einklang bringen zu müssen, wird dadurch gelöst, dass sie für identisch
erklärt werden: Es sei, sagt J.S. Mill, "eine psychologische Tatsache,
dass, etwas für allgemein wünschenswert zu halten und es für lustvoll zu
halten, ein und dasselbe ist"6 Nun
mag das noch zu Mills Zeit plausibel gewesen sein, denkt man an Ausbeutung,
Kinderarbeit und Verelendung im Frühkapitalismus. Aber heute gilt das leider
nicht mehr: 'Tempo 100' und Mülltrennung sind zwar durchaus allgemein wünschenswert,
aber lustvoll leider nicht. Die Glücksverheißung für den einzelnen und für
die Allgemeinheit – das ist ja das Dilemma jeder ökologischen Utopie in der
"Risikogesellschaft" – fallen auseinander. Letztlich sind alle
empirischen Fundierungen als Begründungsversuch von Moral logisch widersinnig:
Was an Erfahrung und Erwartung von Nutzen gebunden ist, kann nicht – rückwärts
– ein Mittel als Zweck begründen. Wenn moralisches Verhalten zum Mittel wird
- um in der Polis glücklich leben zu können, um dem Naturzustand zu entkommen,
um den allgemeinen Nutzen zu maximieren - kann es als Zweck nicht begründet
werden. Ein austauschbares Mittel kann keine allgemeine Gültigkeit
beanspruchen. Das
Beispiel Gentechnologie zeigt: wer hier utilitaristisch argumentiert, wie die
meisten Befürworter, dessen Positionen
haben kurze Halbwertszeiten, sie werden hinfällig, sobald sich ein neuer Nutzen
für eine größere Zahl kalkulieren lässt. Damit
wird deutlich, es gibt keinen inhärenten Maßstab in empirischen Begründungen
, um bestimmte Mittel (z.B.
Folter, Mord) als zweckdienlich auszuschließen. Der Zweck heiligt jedes Mittel.
Empirische Begründungen sind, so Hans Krämer "Bankrotterklärungen der
Moral"7 In
Kants Sprache: empirische Begründungen sagen als "hypothetische
Imperative" nur etwas über die "Legalität" von Handlungen, aber
nichts über deren "Moralität". Das
ist der Hintergrund für Kants deontologische
Begründung. Moralität
wird bei ihm doppelt begründet: Einmal
durch die Kritik an allen bisherigen empirischen Begründungen: Solange
mein Handeln ziel- oder zweckgerichtet ist: das gute Leben, der größte Nutzen
etc. ist es nicht wirklich frei,
sondern innerlich oder äußerlich vorbestimmt. Alle Inhalte von
Willensentscheidungen legen den freien Willen
an die Kette seiner Zwecke. Alle Imperative, die ich mir setze, stehen unter dem
Vorbehalt – der Hypothese
– einen konkreten Zweck erreichen zu wollen, mein Handeln wird damit stets zum
Mittel. Was bleibt ist die reine Form des Willens, das Wollen um des Wollens
willen, ich will, weil ich will, und nicht, um dies und jenes zu erreichen. Erst
der kategorische Imperativ ist also Ergebnis reiner Selbstverpflichtung. Zum
anderen durch den Autonomiebegriff: Moralität wird zum letzten Beweis von
Freiheit, weil erst die autonome,
kategorische Selbstverpflichtung, die von allen inhaltlichen Zwecken, allen
Folgen absieht und nur vom reinen Willen und der Vernunft geleitet ist, wahrhaft
frei ist. Die
Trias von Vernunft, Wille und Moral verdichtet sich im Pflichtbegriff: Zu seiner
wahren Größe erhebt sich der Mensch als pflichtbewusstes Wesen. Die Antwort
auf die Frage, 'warum soll ich moralisch sein?' lautet bei Kant: 'weil es vernünftig
ist.' Natürlich
liegt sofort der Einwand nahe: 'Und warum soll ich vernünftig sein?' Kant hat
den Einwand geahnt, in der Metaphysik der Sitten scheint es am Ende so, als
halte er die Antinomie von Vernunft und Moral für letztlich unlösbar.8
Aber es gibt
weitere Einwände: 1.
Man kann sich so wenig kategorisch selbst verpflichten, wie etwas versprechen,
verzeihen oder bei sich selbst entschuldigen. Anders gefragt: was kommt zuerst:
das Wollen oder das Sollen? Das ist bei Kant nicht eindeutig geklärt.9 Mit Schopenhauer gefragt: "Warum sollte ich, was
ich ohnehin soll, auch noch wollen?"10 Zum Sollen muss ich gewillt sein, dem moralischen Imperativ folge
ich nur, wenn ich dazu motiviert bin, und das Motiv kann letztlich nur mein Glück
sein. Kants
Versuch, das Motivproblem, etwas halbherzig, durch die Vertröstung auf ein
jenseitiges Glück zu lösen, nötigt
ihn, neben dem freien Willen auch noch einen gerechten Gott und eine
unsterbliche Seele anzunehmen. Das ist allerdings, wie Konrad Ott anmerkt: eine
"imposante Verlegenheitslösung."11
Harald Schmitz
urteilt noch schärfer: die Glückseligkeitshoffnung als letztliche moralische
Motivation bei Kant bezeichnet er als "zynischen Eudämonismus".12 In
gewisser Hinsicht ist Kants Moralbegründung damit der religiösen am nächsten
und zugleich am entferntesten von ihr. Sein moralischer Gottesbeweis ist
zugleich der Abgesang auf alle Gottesbeweise. Nach theologischer Auffassung
verpflichten die moralischen Gesetze, weil sie Gottes Gebote sind, nach Kant
sind sie nur deshalb als Gebote Gottes anzusehen, "weil wir dazu innerlich
verpflichtet sind". (KrV, B.847) Die Existenz des Sittengesetzes im
autonomen Menschen begründet die Existenz Gottes. 2.
Kants Ethik macht keinen sinnvollen Umgang mit ethischen Konflikten möglich:
reine praktische Vernunft, freier
Wille und Selbstverpflichtung sind rigorose Instanzen, die keine Konflikte, kein
Abwägen vorsehen, aber darum
geht es in der moralischen Praxis meist. 3.
Freier Wille, Pflichtbewusstsein und Vernunft erscheinen seit Marx, Darwin,
Nietzsche und Freud ohnehin in trübem Licht. Die
Kritik an Kant ist auch der Ausgang intuitionistischer
Begründungsansätze. Schopenhauers
Mitleidsethik relativiert
sein extrem kritisches Menschenbild durch die Zuschreibung einer elementaren
Fähigkeit zum Mitleiden. Moral gründet in der Empathiefähigkeit. Schopenhauer
muss versuchen, Mitleid
mit seiner Annahme eines grenzenlosen Egoismus beim Menschen kompatibel zu
machen. Das unternimmt
er mit einer Projektionsthese: So wie ich im Allgemeinen und weit überwiegend
mein eigenes Wohl zum obersten Ziel mache, so verfüge ich über die Fähigkeit,
durch Hineinversetzen in den anderen, sein Wohl zu meinem elementaren Anliegen
zu machen. Meine Mitleidsfähigkeit ist die einzige, und um des Zusammenlebens
willen notwendige, Relativierung meines ansonsten grenzenlosen Egoismus. Die
Wertethik
Schelers kritisiert
den Kant'schen Vernunftbegriff: "Eine praktische Vernunft, die dem Triebbündel
(Mensch) erst ihre Form aufzupressen hätte, gibt es nicht!" 13 An
die Stelle von Vernunft bzw. freiem Willen setzt Scheler die, seiner Meinung
nach elementaren, Gefühle von Liebe und "sittlicher Werterkenntnis".
Was ein sittlicher Wert ist, das sagt mir weder die Vernunft, noch der Wille,
noch die Pflicht, sondern allein die Intuition, bzw. meine natürliche Liebesfähigkeit. Die
aktuelle Diskussion um die Bedeutung moralischer Gefühle für die Begründbarkeit
von Moral, in den Care-
und Achtsamkeitsethiken etwa,
rekurriert ebenfalls auf den Intuitionismus. Letztlich gehen alle
intuitionistischen Ansätze auf Platons Ideenlehre zurück: die Ideen des
'Guten' und des Gerechten sind oberste, von menschlicher Erkenntnis unabhängige
'Werte', sie gehören als Tatsachen zur Welt und beanspruchen den höchsten
Wahrheitsgehalt. Wie
aber, so muss man fragen, ist etwas vorstellbar, das zugleich reale empirische
Tatsache ist und einen normativen
Anspruch erhebt? Diese seltsame Doppelnatur der intuitiv gefassten Werte bleibt
reine Metaphysik. Die
Dinge der Welt fordern nichts. Zudem
ist Intuition ein schlechter Ratgeber, wenn es um allgemeine Gültigkeit
moralischer Werte geht: sie kann uns verlassen – oder erst gar nicht
auftreten. Als Begründung ist der Intuitionismus zirkulär: wer die Intuition
hat, braucht keine Begründung, wem sie fehlt, dem hilft keine. Anthropologisch-biologische
Begründungen scheinen handfester. Sie entstehen mit Darwin und sind heute in
zwei Varianten – als Soziobiologie und als Verhaltensforschung – in der
aktuellen Diskussion. Beide
Varianten können nur eine Minimalmoral begründen: als Familien-Altruismus, der
dem Zweck der eigenen Gen-Vermehrung dient – und schon damit als Begründung
entfällt, weil Altruismus hier falsch verstanden ist: altruistisch
handelt nur, wer von der eigenen Person, von eigenen Interessen absieht. Wer zu
seinen nächsten Verwandten
freundlich ist, um den eigenen Genpool zu sichern, der handelt nicht
altruistisch, sondern egoistisch. –
oder als Stammes-Altruismus, der sich durch Gruppenselektion ausprägt. Aber
das bleiben Moralen für Urmenschen – oder Affen, wie Frans de Waal zu zeigen
versucht. Viele Forscher, etwa Konrad Lorenz, betonen ausdrücklich, dass
moralische Anforderungen für moderne Menschen biologisch nicht begründbar
sind. Eine naturwissenschaftlich erhärtete anthropologische Begründung von
Moral ist zu schön – um wahr zu sein. Was
bleibt, sind drei aktuelle Begründungsansätze . Alle
sind auf dem Hintergrund der Kritik aller bisherigen Begründungsversuche zu
sehen. Zum
einen die Diskursethik: Sie
hält zwar an Kants Prämissen fest, versucht aber den Mangel zu überwinden,
dass moralische Entscheidungen bei Kant einsame Einzelentscheidungen von
Individuen sind. Was moralische Gültigkeit beanspruchen darf, ergibt sich in
der Diskursethik erst a posteriori als Konsens in einem herrschaftsfreien
Diskurs. Habermas: "Statt
allen anderen eine Maxime, von der ich will, dass sie ein allgemeines Gesetz
sei, als gültig vorzuschreiben, muss ich meine Maxime zum Zweck der diskursiven
Prüfung ihres Universalitätsanspruchs allen anderen vorlegen. Das Gewicht
verschiebt sich von dem, was jeder (einzelne) ohne Widerspruch als allgemeines
Gesetz wollen kann, auf das, was alle in Übereinstimmung als universale Norm
anerkennen wollen " 14
Apel versucht eine
"Letztbegründung" von Moral (auf die Habermas verzichtet) mit dem
Verweis auf das "Apriori der Kommunikationsgemeinschaft", d.h., der
Umstand, dass menschliche Sprache von Anfang an auf Verständigung
gerichtet ist, sei eine 'unhintergehbare' Tatsache. Auf Kommunikation gerichtete
Sprache enthält damit
von Beginn an ein moralisches Element, insofern jede Äußerung auf ihr
Verstanden-Werden-Wollen hin angelegt
ist, den 'Anderen' also stets von Anfang an mit einbezieht. Der
Charme der Diskursethik liegt zum einen darin, dass sie eine gleichsam
demokratische, zivilgesellschaftliche Variante der Pflichtethik bietet, und
dieser so die puritanische Spitze bricht, zum anderen, wie Habermas selbst
betont, im "Wechsel der Perspektive von Gott zum Menschen. 'Gültigkeit'
bedeutet jetzt, dass moralische Normen die Zustimmung aller Betroffenen finden können,
sofern diese nur... gemeinsam prüfen, ob eine entsprechende Praxis im gleichmäßigen
Interesse aller liegt."15 Die
Kritik setzt an den Regeln an, die Habermas für eine ideale
Kommunikationssituation vorgibt. Der
Hauptvorwurf betont die Zirkularität der Argumentation: die Diskursbedingungen
der Diskursteilnehmer – frei,
gleich, vernünftig etc. – setzten bereits bei Beginn des Diskurses voraus,
was erst Ergebnis, im Konsens, sein kann.16 Zweitens:
Ziel der Diskurse sei in Wirklichkeit nicht der Konsens, sondern der Dissens,
der Widerstreit, "La différance"
(Lyotard) Konsens ist bestenfalls ein Zwischenstadium, am Ende steht die
Paralogie.17 Drittens:
Die Bedingung, dass die Diskursteilnehmer "sagen, was sie meinen" (Habermas)
ist uneinlösbar. Sie übersieht,
dass wir uns missverstehen können, ohne es zu bemerken. Die hinter der
Bedingung stehende Referenztheorie
der Sprache ist linguistisch nicht mehr haltbar. Der Dekonstruktivismus hat
zuletzt gezeigt, wie sehr, gerade in philosophischer Sprache, die Metaphorik die
Begrifflichkeit, und damit das Welt- und Menschenbild
prägen. (Derrida) Da auch Metaphern der wittgensteinschen Bestimmung folgen,
dass die Bedeutung
eines Begriffs die Regel seines Gebrauchs ist, gibt es keine Metaphern an sich,
sondern nur metaphorische
Verwendung von Sprache, daher auch kein 'Eigentliches', daher auch keine
eindeutige Unterscheidung
von sagen und meinen. Und: selbst wenn ich sagen könnte, was ich meine, bleibt
fraglich, ob der Hörer weiß, was ich meine, mit dem, was ich sage. Habermas
selbst hat im Übrigen in jüngeren Arbeiten den Geltungsanspruch der
Diskursethik hinterfragt: Er sieht das Motivationsproblem jeder kognitiven,
keine Erlösung verheißenden Moralbegründung, wenn er zugesteht: "Weil
es keinen profanen Ersatz für die persönliche Heilserwartung gibt, entfällt
das stärkste Motiv für die Befolgung
moralischer Gebote." Auch wenn wir in rationalen Diskursen ausgehandelt
haben, was moralisch richtig ist, verhindert das nicht, "dass andere Motive
nicht doch die stärkeren sind."18 Und
deshalb sei letztlich jede Vernunftmoral "auf ein Recht angewiesen, das
normenkonformes Verhalten bei Freistellung der Motive ...erzwingt."19 Das
hört sich schon recht pragmatisch an: Wo der Geltungsanspruch von Moral nicht
mehr greift, da greift das Gesetz.
Eine tatsächliche pragmatische
Moralbegründung,
wie sie in Amerika entwickelt wurde, argumentiert allerdings anders. Peirce
formuliert die pragmatische Grundüberzeugung: Die Welt ist uns nicht als solche
gegeben, sondern immer nur in den Begriffen, die wir uns von ihr machen, und:
die praktischen Wirkungen des Gegenstands unseres Begriffs in unserer
Vorstellung, das ist das Ganze des Begriffs des Gegenstands. R.
Rorty formuliert es pointierter: Wahrheit ist "was zu glauben für uns gut
ist."20 Solche
Formulierungen trugen dem Pragmatismus den Ruf ein, eine "Händlerphilosophie"
zu sein. All
unsere Vorstellungen, auch die ethischen mithin, sollen auf ihre möglichen
praktischen Wirkungen hin beurteilt werden. Der teleologische Grundzug wird hier
deutlich. Zentral
ist ein dialektischer Begriff von Kontingenz: Sprache, Kultur, Selbstbild, auch
Moral sind zufällig, d.h. einerseits
könnten sie genauso gut anders sein, andrerseits prägen sie die Menschen
durchaus. Auch wenn all unsere
moralischen Überzeugungen nichts als "Produkte von Zeit und Zufall"21
sind, können wir
uns doch nicht anders
entscheiden. Die Begründung von Moral liegt einmal in der Tradition einer
moralischen Gemeinschaft, zum anderen darin, dass sie nützlich ist.
Entsprechend, so Rorty, wäre es für einen Kosovo-Albaner eine moralische
Zumutung – und lebensgefährlich - sollte er einen Serben als gleichwertigen
Menschen betrachten.22 Dennoch:
Der Pragmatismus hält an der Idee der Aufklärung fest, glaubt, dass
"Menschenrechtskultur" erweitert und verbreitet werden kann, aber
nicht durch Vernunftappelle, nicht im Diskurs oder per Dekret , sondern nur
durch Verbesserung der Lebensumstände und durch Empathie. Die beiden Aspekte hängen
kausal zusammen: Man muss es sich leisten können, moralisch zu sein. Daher ist
die Verbesserung der Lebensumstände das beste – und im Grunde einzige –
Mittel, die Moralität zu befördern. "Erst kommt das Fressen, dann kommt
die Moral." Wenn Rorty darauf verweist, die Lektüre von "Onkel Toms Hütte"
habe die Moral mehr befördert, als 200 Jahre Kategorischer
Imperativ 23 so
steckt dahinter eine Umwertung von Ethik und Ästhetik. Die
Ethik, als Teil der Philosophie, dreht sich im Kreis und verharrt im unernsten
Streit ums Recht-haben; die Literatur,
als Teil der Künste, hingegen befördert die moralische Sensibilität für die
Leiden des anderen, schult unsere
Empathiefähigkeit und relativiert unser Selbstbild. Aber:
Die moralischen Gefühle halten nicht vor: beim nächsten Taxi-Mord heißt es
wieder: Kopf ab. Sie sind, das macht sie so verlockend, viel leichter evozierbar
aber auch manipulierbar, als rationale Einsichten, und letztlich sind moralische
Gefühle moralisch neutral: Scham, Schuld und Reue kann auch der Verbrecher
empfinden, der seinen Komplizen verrät; empören und entrüsten kann man sich
auch über die Erniedrigten und Beleidigten, das tiefe Mitleid mancher Tierschützer
geht einher mit zynischer Menschenverachtung. Der
moralische Relativismus hat keinen Maßstab, Unmoralisches zu qualifizieren. G.W.
Bush und Osama bin Laden,
der Papst und die Moon-Sekte begründen ihre Moralen demnach mit gleichem
Geltungsanspruch. Ist eine Ethik, die dies zulässt, wirklich gut begründet? Schließlich
der postmoderne Ansatz. Die
erwähnte Kritik an der Diskursethik ist der Ausgangspunkt postmoderner Ethik. Sie
geht nochmals zurück zur ersten Begründung: die religiöse ist für sie die
eigentliche – und einzig ehrliche. Wenn
sie nicht
mehr gilt, und natürlich geht die Postmoderne davon aus, sind alle anderen
Versuche Ersatz, Metaphysik,
ein hoffnungsloses Verlangen, die Einheit von Vernunft und Mythos, Denken und Fühlen,
Begriff und Empfindung zu bewahren, bzw. wiederzubeleben. Aber diese Einheit ist
endgültig verloren. Eine
normative Begründung von Moral diesseits der jenseitigen erscheint der
Postmodernen hoffnungslos. Ihren radikalen Skeptizismus entfaltet sie in
folgenden Schritten:24 1.)
Der Mensch ist ein moralisch ambivalentes Wesen. Diese Ambivalenz ist
unaufhebbar, alle Versuche, den moralisch-besseren
Menschen zu erziehen, münden in Gesinnungsdiktatur, Tugendterror und
Grausamkeit. Es gibt keine Garantie für Moralität, wer sie dennoch erstrebt,
verschlimmert nur die Lage. 2.)
Moral ist "inhärent nicht-rational". Sie zeigt sich weder aus
utilitaristischem Kalkül, folgt keinen Zweck- und Nützlichkeitserwägungen,
noch ist sie Prinzipien- oder Maximen-geleitet. Nicht aus Lust, noch aus Pflicht
handeln wir moralisch, sondern aus spontanem Impuls. Das autonome moralische
Gewissen ist nicht einklagbar, mal schlägt es, mal schweigt es. 3.)
Ethik irritiert nur die Moral. Sie nutzt den spontanen moralischen Impuls für
ihre Steuerungs-absichten, will ihn zügeln, zähmen, dirigieren – und zerstört
ihn dadurch. Sie verschiebt Moral aus dem Bereich persönlicher Autonomie
in machtgestützte Heteronomie, sie will erlernbare Regeln, ethisches Wissen an
die Stelle subjektiver moralischer Verantwortung setzen und sieht nicht, dass
Moral das Chaotische ist, inmitten einer rationalen Ordnung. 4.)
Moralität ist aporetisch. Die Folgen moralischer Handlungen sind fast stets
uneindeutig, widersprüchlich. Selten sind moralische Handlungen eindeutig gut,
meist hingegen ein Abwägen im Konfliktfall, was negative Folgen einschließt.
Daher auch unsere Unsicherheit, wenn wir moralisch handeln. So kann etwa selbst
vermeintlich so eindeutig Gutes, wie Hilfsbereitschaft in Abhängigkeit und
Beherrschung des Hilfesuchenden umschlagen. 5.)
Moral ist nicht universalisierbar. Das heißt nicht, dass sie vollkommen
relativ, beliebig ist, wohl aber stülpt der Universalismus in seiner bekannten
Form einen ethischen
Code über alle,
versucht die moralische Gleichschaltung, die Verallgemeinerung einer einzigen,
westlichen Moral – und erreicht damit doch nur ein Verstummen der
"wilden, autonomen, widerspenstigen, unkontrollierten Ursprünge
moralischer Urteilskraft."25
Indes, ein
konsequenter Relativismus, der die Gleich-Gültigkeit kulturspezifischer Moralen,
ja, lokalen Brauchtums propagiert, ist nicht die Alternative zum europäisch-rationalistischen
Universalismus; da die Vielfalt an Moralen sich widersprechen, gar
neutralisieren können, führt er letztlich in die moralische Beliebigkeit, den
Nihilismus. 6.)
Moral ist also nicht relativ. Dies sind nur die verschiedenen ethischen Codes,
die versuchen, echte, spontane, natürliche Moralität durch ihre vorgefassten
Normen und Regeln zu ersetzen. Die Moral selbst ist autonom, die heteronomen
Ethiken sind es, die die Utopie eines befreiten, moralisch-autonomen Subjekts
verhindern. 7.)
Moralität ist nicht begründbar. Vielmehr geht sie allen Begründungsversuchen
voraus, steht auch gar nicht unter Begründungszwang. Sie geschieht einfach –
oder nicht – ex nihilo. Auch erfordert sie keine Überwindung, kein Absehen
vom Eigensinn, keinen Widerspruch zur menschlichen Natur, kein kaltes Kalkül.
Sie ist da. 8.)
Moralität ist das Erwachen der Verantwortung für den Anderen. Erst im Blick
des Anderen erkenne ich mich selbst ganz, und damit zugleich als moralisches
Selbst. Die wahre Autonomie, als Abgrenzung vom Anderen, ist nur durch die
Hinwendung zu einem konkreten Anderen möglich. Zigmunt
Bauman: "Ich
bin ich, insoweit ich für den anderen bin...Verantwortung, die übernommen
wird, als ob sie immer schon da war, ist die einzige Begründung, welche die
Moral haben kann." 26 Hier
scheint die Utopie einer vollendeten Selbst-Findung des Menschen durch
Hinwendung zum anderen auf: Mein
'wahres' Selbst wird erst in vollkommener "Selbstlosigkeit" (Lévinas)
zu finden sein. – Allerdings nur, wenn ich es suche.. Jede intersubjektive
Verbindlichkeit, jeder von außen vorgetragene Geltungsanspruch über das persönliche
Bedürfnis, Verantwortung für den anderen zu übernehmen, hinaus, ist so
verschwunden. Aber:
wenn wir das
zugeben, ist Moral, es sei denn krypto-religiös, nicht begründbar, damit kann
sie keine Geltung
beanspruchen, ist nichts Intersubjektives mehr – und damit jede normative
Fundierung verschwunden. Womit
wir wieder am Anfang wären. 3.
M1 Möglichkeiten und Grenzen 'hedonistischer Kalküle' Aufgabe: Entwerfen
Sie ein 'hedonistisches Kalkül". Berücksichtigen Sie dabei möglichst
viele der von Bentham vorgeschlagenen Maßstäbe zur Beurteilung von Lust und
Leid bei möglichst vielen Betroffenen Ihrer Entscheidung. -
Formulieren Sie Ihr ethisches Gesamturteil: wie würden Sie handeln? -
Halten Sie den Konflikt für lösbar mithilfe eines hedonistischen Kalküls?
Formulieren Sie Ihre Bedenken.
Bau
einer Umgehungsstraße: Sie
müssen als Bürgermeister Ihres Orts darüber entscheiden, welche Trassenführung
einer neu zu bauenden
Umgehungsstraße die richtige ist. Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder eine
kürzere und billigere Strecke, die aber relativ nahe an einem Neubaugebiet mit
Reihenhäuschen vorbeiführt oder eine längere und teurere Variante über
abgelegene Felder, die aber den städtischen Haushalt stark belastet.
Organspende:
Widerspruchsprinzip Angenommen,
in Ihrem Staat gilt jeder Bürger als Organspender, der nicht ausdrücklich
Widerspruch dagegen
einlegt, nach seinem Tod als Organspender genutzt zu werden. Wie würden Sie
sich verhalten? Akzeptieren Sie die allgemeine Bestimmung oder legen Sie
Widerspruch dagegen ein? 3.
Gruppe: DNA-Analyse
zur Verbrechensbekämpfung Sie
müssen, als Abgeordnete darüber entscheiden, ob Sie einem Gesetzentwurf
zustimmen wollen, der eine DNA-Analyse für alle männlichen Einwohner eines
Orts vorschreibt, um im Fall eines schweren Sittlichkeitsverbrechens den Täter
leichter feststellen zu können. Die Daten sollen nur der Polizei zugänglich
sein und nur bei Mordfällen genutzt werden dürfen. 4.
Gruppe: Experimente
an Nicht-Einwilligungsfähigen Sie
haben, als Mitglied des Europarats, darüber zu entscheiden, ob Sie einem
Gesetzentwurf zustimmen, nach dem erlaubt sein soll, geistig Schwerbehinderte,
demente Alte, Embryos und Neugeborene für medizinische Experimente
(Medikamenten- und Behandlungstests) zu nutzen, wobei die Experimente keine
bleibenden Schäden verursachen dürfen. Eine Zustimmung der Be-troffenen soll
– bzw. kann – dabei nicht erforderlich sein. 4.
M2 Zur
Einführung Was
soll ich tun? Ein Problem der Moral Tag
für Tag stehen wir - ohne uns dagegen wehren zu können – vor der Frage:
„Was soll ich tun? Wie soll ich mich meinen Mitmenschen gegenüber
verhalten?" Die Antwort darauf kann äußerst schwer fallen, wie der
folgende Fall zeigt: Zu
dem Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts kommt eines Tages ein kleines Mädchen,
das weder lesen noch schreiben kann. Es weiß auch nicht, wie teuer die von ihm
verlangte Tafel Schokolade ist. So würde es, wenn der Kaufmann es fordert,
genau so gut 5 Euro wie 10 Cent dafür bezahlen. Der Kaufmann weiß dies, und er
könnte das Kind deshalb leicht „übers Ohr hauen". Soll er es tun oder
nicht! Folgende
Überlegungen gehen ihm dabei im Kopf herum: 1.
Weil die Kleine so hübsch ist, werde ich von ihr den normalen Preis verlangen. 2.
Ich muß sie ehrlich bedienen, denn mein Betrug könnte herauskommen und
unangenehme Folgen für mich haben. 3.
Einmal ist keinmal! 4.
Wenn das alle tun würden, könnte keiner mehr dem anderen trauen! 5.
Ehrlich währt am längsten! 6.
Gar keine Frage, ich muß immer ehrlich sein! Wie
würden Sie sich in diesem Fall entscheiden? Warum? Welche Überlegung des
Kaufmanns erscheint Ihnen richtig! Warum? (Aus:
Michael Wittschier: Alle Kreter lügen..., sprach der Kreter. Kleine Einführung
in die Philosophie. Düsseldorf: Patmos 1980. S. 34) M3a
Max Stirner: Ich hab' mein Sach' auf Nichts gestellt (Max
Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, (1844), Frankfurt a. M. 1986, S. 5 ff) Was
soll nicht alles meine Sache sein! Vor allem die gute Sache, dann die Sache
Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität,
der Gerechtigkeit; ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines
Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur
meine Sache soll niemals meine Sache sein. "Pfui über den Egoisten, der
nur an sich denkt!" Sehen
wir denn zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache wir
arbeiten, uns hingeben und begeistern
sollen.[...] Nun,
es ist klar, Gott bekümmert sich nur ums Seine, beschäftigt sich nur mit sich,
denkt nur an sich und hat sich im Auge; wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig
ist. Er dient keinem Höheren und befriedigt nur sich. Seine Sache ist eine rein
egoistische Sache. Wie
steht es mit der Menschheit, deren Sache wir zur unserigen machen sollen? Ist
ihre Sache etwa die eines anderen
und dient die Menschheit einer höheren Sache? Nein, die Menschheit sieht nur
auf sich, die Menschheit will nur die Menschheit fördern, die Menschheit ist
sich selber ihre Sache. Damit sie sich entwickle, lässt sie Völker und
Individuen in ihrem Dienste sich abquälen, und wenn diese geleistet haben, was
die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbarkeit auf den Mist der
Geschichte geworfen. Ist die Sache der Menschheit nicht eine rein egoistische
Sache? [...] Gott
und die Menschheit haben ihre Sache auf nichts gestellt, auf nichts als auf
sich. Stelle ich denn meine Sache gleichfalls auf mich, der ich so gut wie Gott
das Nichts von allem anderen, der ich mein alles, der ich der einzige bin. [...] Fort
denn mit jener Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist! Ihr meint, meine
Sache müsse wenigstens die "gute Sache" sein ? Was gut, was böse!
Ich bin ja selber meine Sache, und ich bin weder gut noch böse. Beides hat für
mich keinen Sinn. Das
Göttliche ist Gottes Sache, das Menschliche Sache "des Menschen".
Meine Sache ist weder das Göttliche noch
das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie usw., sondern allein
das meinige, und sie ist keine allgemeine, sondern ist einzig, wie ich einzig
bin. Mir geht nichts über mich! Fragen:
M3b
Ethik ohne Zukunft? Zur Zukunft der Ethik (Otto
Peter Obermaier, in: Der blaue Reiter, Heft: Ethik, 1, 1996, S. 8) Der
Blick in die Medien genügt: Da predigt ein Pfarrer eherne Werte und zieht sich
abends widerliche Kinderpornos
rein. Ist das christliche Moral? Da beruft sich der Abgeordnete auf sein
Gewissen, während seine Aktivitäten
schierem Bereicherungsaktivismus gleichen. Da infizieren Mediziner Patienten mit
Syphilis und behandeln
sie nur scheinbar, um endlich Studienobjekte für das Tertiärstadium dieser
Krankheit zu haben. Ist das das Ethos der Wissenschaften? Da umarmen
demokratische Politiker Diktatoren, deren Atem nach Massenmord, Folter und
Brutalität stinkt. Ist es vielleicht doch korrekt, wenn Herbert Marcuse
schreibt: "Nicht das Bild einer nackten Frau, die ihre Schamhaare entblößt,
ist obszön, sondern das eines Generals in vollem Wichs, der seine in einem
Aggressionskrieg verdienten Orden zur Schau stellt." Ist
Ethik also nicht mehr als eine intellektuell und argumentativ aufgeblasene
Lusche, ein System aus vollmundigen
Sprüchen, Sollensforderungen und Imperativen, eine Ansammlung schicker
Tugenden, Werte, geschickter
Rechtfertigungen, ein Instrument für Sonntagsreden und das Kleinvieh eines
Volkes, während das Großvieh
jenseits ethischer Forderungen operiert? Oder zeigt sich gar in dieser Kluft
zwischen Sein und Sollen, zwischen
Wirklichkeit und Anspruch, zwischen dem Reich des Faktischen und dem Reich des
Gewünschten, das Spezifische jeder Ethik? Hat denn ein System, das
Beurteilungen unserer Handlungen und Unterlassungen leisten
und unseren Lebensvollzug, sprich Praxis, lenken soll noch Zukunft, wenn es
allenfalls zur intellektualistischen und populistischen Selbstbefriedigung
taugt, aber sonst permanent und kläglich versagt? Ethik
hat es traditionellerweise mit der Auszeichnung von Handlungen und
Unterlassungen mit gut oder böse zu tun, aber ganz offensichtlich juckt es die
Wirklichkeit wenig, was Moralisten krähen. Müsste sich Ethik nicht auch schon
längst mit dem, was wir Herstellen und Produzieren nennen, beschäftigen und
nicht nur mit unseren Handlungen, wenn sich dieses Produzieren vehement in unser
Handeln gedrängt hat? All
diese Beispiele und Fragen zeigen Eigentümlichkeiten jeder Ethik. Wir sind zwar
eingekreist von Tausenden von Sollensforderungen, Pflichten, Imperativen,
Geboten, Tugenden, Werten, aber trotz diesem Heer aus Appellen und Ansprüchen
besteht die Freiheit und die Möglichkeit, all dies zu missachten. Das Prädikat
"böse" juckt mitunter weder die Mächtigen noch jene, in deren Herzen
sich kein Gefühl der Verpflichtung gegenüber all diesen Sollensforderungen
breitgemacht hat. Ethik
ist ein zahnloser Tiger, dem nur dann Zähne wachsen, wenn wir an ihre Aussagen
glauben und danach handeln.
Das Reich der Ethik ist nicht das der Fakten: Obgleich diese anders
"laufen", bleiben ethische Forderungen
in Kraft. Der Satz: "Du sollst nicht töten" beansprucht seine Gültigkeit
auch dann noch, wenn permanent
getötet wird. Hierin zeigt sich einesteils der "transfaktische
Anspruch" (transfaktisch = jenseits der Tatsachen)
jeder Ethik, anderenteils ihre fundamentale Ohnmacht. Jede Ethik ist mit dieser
Eigentümlichkeit belastet,
es kommt nur darauf an, das Reich der Ohnmacht zu verkleinern. Der Schatten, der
jede Ethik begleitet, heißt Ohnmacht. Aufgaben: 1.
Formulieren Sie die kritischen Einwände des Texts gegen die Ethik in eigenen
Worten. 2.
Finden Sie weitere Beispiele für die Wirklichkeitsfremdheit von Ethik. 3.
Welchen Ausweg aus der "Ohnmacht" der Ethik deutet der Text an? 4.
Welche Bedeutung hat die Begründung von Ethik für ihre Gültigkeit? M4
Karl und Karla: Zwei Probleme mit der Moral (Kurt
Bayertz, Hg, Warum moralisch sein?, Paderborn 2002, S. 9 f.) Stellen
wir uns zwei Situationen vor, in denen Menschen ein moralisches Problem haben.
In der ersten Situation
findet jemand (nennen wir ihn Karl) an einsamer Stelle eine Brieftasche. Ihr
Inhalt besteht aus mehreren tausend Euro sowie der Visitenkarte des Besitzers:
es handelt sich um einen stadtbekannten Immobilienspekulanten. Karl
weiß natürlich, daß er die Brieftasche 'eigentlich' ihrem Besitzer zurückgeben
sollte; dennoch zögert er. Der Grund seines Zögerns liegt darin, daß er als
Mitglied des örtlichen „Solidaritätskomitees gegen den Hunger in der Dritten
Welt" weiß, daß die gefundene Summe ausreichen würde, um eine mittelgroße
Meerwasserentsalzungsanlage in einem afrikanischen Dorf zu bauen; eine solche
Anlage würde etlichen Familien einen ausreichenden Lebensunterhalt als Bauern
ermöglichen. Karl empfindet einerseits die Verpflichtung zur Rückgabe des
Geldes; andererseits aber auch die Verpflichtung, den vom Hunger bedrohten
Dorfbewohnern zu helfen. - Auch in der zweiten Situation findet jemand (nennen wir sie Karla) an
einsamer Stelle die Brieftasche eines reichen Immobilienspekulanten mit mehreren
tausend Euro. Auch
Karla kennt die grundsätzliche moralische Verpflichtung, Gefundenes zurückzuerstatten;
und auch sie zögert. Der Grund dafür ist jetzt aber ein anderer. Karla möchte
nämlich seit langem einen Urlaub in einem komfortablen Golfhotel auf den
Bahamas verbringen, von dem ihr gutbetuchte Freunde vorgeschwärmt haben; die
gefundene Summe würde ausreichen, diesen Urlaub zu finanzieren. Karl und Karla
sind beide gleichermaßen reflektierte Menschen und fragen sich daher ernsthaft,
was sie in ihrer jeweiligen Situation tun sollen. Doch obwohl sich die jeweilige
Situation beider durchaus ähnelt, unterscheiden sich ihre Überlegungen
grundlegend. Für Karl geht es um die Frage, was die Moral in dieser
spezifischen Situation von ihm fordert. Er befindet sich im Zwiespalt zwischen
zwei moralischen Forderungen und fragt sich, welche von ihnen schwerer wiegt,
d.h. er fragt, was das moralisch Richtige ist. Wir
können annehmen, daß er seine Überlegungen anstellt, weil ihm daran gelegen
ist, das moralisch Richtige
zu tun. - Anders im Falle Karlas. Ihr ist völlig klar, was das moralisch
Richtige ist: nämlich das gefundene Geld zurückzugeben. Karla hat in diesem
Fall schon die Antwort, die Karl noch sucht. Sie fragt aber, ob sie das
moralisch Richtige auch tun
soll. Was bei
Karl bereits vorausgesetzt war, wird bei Karla zum Problem: Soll
ich moralisch sein? Und
wenn ja: Warum? Fragen: 1.
Auf welche zwei Weisen kann man die Frage nach der Begründung von Moral
verstehen? 2.
Wer stellt die grundsätzlichere Frage: Karl oder Karla? 3.
Wer braucht eine Moralbegründung: Karl oder Karla? 4.
Was würden Sie Karl antworten, was Karla? M5
Begründung von Moral Kleine
Kinder bringen ihre Eltern oft mit einer Reihe von Warum-Fragen zur
Verzweiflung: "Warum regnet es?" – "Und
warum gibt es Wolken?" – "Und warum verdunstet das Wasser?" – "Und
warum ist die Sonne so heiß? usw. Dabei fallen den Eltern die Antworten bald
immer schwerer. Solches
Nachfragen gibt es auch, wenn es um Moral geht. Stellen wir uns folgende
Ausgangssituation vor: Die kleine
Vanessa hat einer Freundin, der sie eine Puppe als Geschenk versprochen hat,
diese nicht gegeben, weil ihr eine andere Freundin im Tausch gegen die Puppe
einen Teddybären gab. Das erzählt sie ihrer Mutter. Die ist empört und sagt
der Tochter, sie habe unrecht gehandelt. Vanessa
fragt: "warum denn?" Aufgabe:
Versuchen Sie nun, das Gespräch weiterzuführen, bei dem die Eltern mit immer
neuen 'Weil'-Antworten
auf die 'Warum'-Fragen Vanessas reagieren. Versuchen Sie, das Gespräch über möglichst
viele 'Runden' zu verfolgen. Eltern:
"weil... Vanessa:
und warum.... Eltern:
"weil... Vanessa:
"und warum.... Eltern:
"weil... Vanessa:
"und warum.... Eltern:
"weil... M6
Acht Begründungen von Moral 1.
"Nun
stelle man sich einmal vor, man lebe mit zehn bis fünfzehn seiner besten
Freunde sowie deren Frauen und Kinder in einer...Sozietät. Die paar Männer müssen
notwendigerweise zu einer verschworenen Gemeinschaft werden, sie sind Freunde
im wahrsten
Sinne des Wortes. Jeder hat dem anderen viele Male das Leben gerettet und eine
gewisse Rivalität...trat stark zurück hinter der ständigen Notwendigkeit,
sich gemeinsam gegen die feindlichen Nachbarn zu wehren. Man musste gegen diese
so oft um die Existenz der eigenen Gemeinschaft kämpfen, dass alle Triebe
intra-spezifischer Aggression reichlich Absättigung nach außen hin fanden. Ich
glaube, jeder von uns würde unter diesen Umständen gegen seine Genossen in
jener Fünfzehn-Mann-Sozietät schon aus natürlicher Neigung die zehn
Gebote...halten und jene weder töten noch verleumden, noch auch einem von ihnen
(etwas) stehlen." 2.
"Denn die
sittliche Tugend hat es mit Lust und Unlust zu tun. Der Lust wegen tun wir ja
das sittlich Schlechte, und der Unlust
wegen unterlassen wir das Gute. Darum muss man...von der ersten Kindheit an
einigermaßen dazu angeleitet worden sein, über dasjenige Lust oder Unlust zu
empfinden, worüber man soll. Denn das ist die rechte Erziehung." 3.
"Es ist überall
nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was
ohne Einschränkung für gut könnte
gehalten werden, als allein ein guter Wille...Der gute Wille ist nicht durch
das, was er bewirkt oder ausrichtet, noch durch
seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines vorgesetzten Zwecks, sondern
allein durch das Wollen, d.i. an sich gut." 4.
"Denn ich
weiß euer Übertreten, des viel ist, und eure Sünden, die stark sind, wie ihr
die Gerechten drängt, und Blutgeld nehmt
und die Armen unterdrückt....Suchet das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr
leben mögt, so wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmet.
Hasset das Böse und liebet das Gute, bestellet das Recht im Tor, so wird der
Herr...den übrigen gnädig sein." 6.
"Verantwortung
beschwört das Antlitz herauf, dem ich mich zuwende, aber sie erschafft mich
auch als moralisches Selbst. Verantwortung zu übernehmen, als sei ich bereits
verantwortlich gewesen, ist ein Akt der Erschaffung des moralischen Raums, der
nicht anderweitig oder anderswo plaziert werden kann. Diese Verantwortung, die
übernommen wird, als ob sie immer schon da war, ist die einzige Begründung,
welche die Moral haben kann. Eine zerbrechlich-zarte Begründung, muss man
zugeben." 7.
"Wenn nun
unterstellt werden kann, dass die Vernunft von Anfang an auf Kommunikation, und
das bedeutet auch: Kooperation
unter Vernunftsubjekten, angelegt und angewiesen ist, von
Anfang an also sozial verfasst ist, dann[...]
können die in der Vernunft immer schon enthaltenen Regeln für das friedliche
Miteinander aufgedeckt werden als vernünftig nicht zu bestreitende, immer schon
von jedermann anerkannte Normen von ganz unzweifelhaft moralischem Gehalt." 8.
"Geborgenheit
und Mitgefühl gehen miteinander einher und zwar aus denselben Gründen, aus
denen Frieden und wirtschaftliche
Produktivität miteinander einhergehen. Je schwieriger die Verhältnisse, je größer
die Anzahl der furchterregenden
Umstände, je gefährlicher die Situation, desto weniger kann man die Zeit oder
die Mühe erübrigen, um darüber
nachzudenken, wie es denjenigen ergeht, mit denen man sich nicht ohne weiteres
identifiziert. Die Schule der Empfindsamkeit
und des Mitgefühls funktioniert nur bei Leuten, die es sich lange genug bequem
machen können, um zuzuhören." Aufgaben: 1.
Wie wird in diesen acht Aussagen jeweils Moral begründet? Finden Sie in jedem
Text ein zentrales Stichwort dazu, oder formulieren Sie selbst in Schlagworten. 2.
Von wem könnten die Texte stammen? Spekulieren Sie. M7
Begründbarkeit ethischer Normen
Diese
Frage kann einmal als Frage nach der moralischen
Rechtfertigung
richtigen Handelns verstanden werden. Dann lautet die Antwort, daß moralisch
richtiges Handeln keiner Rechtfertigung bedarf, da schon die Gründe dafür,
dass etwas richtig ist, rechtfertigend wirken. So verstanden, würde die Frage
ja lauten: „Warum soll ich im moralischen Sinn tun, was moralisch richtig
ist?" Die Frage kann jedoch auch als Aufforderung zu einer außermoralischen
Rechtfertigung
moralisch richtigen Handelns verstanden werden, als Verlangen nach Gründen,
warum wir uns in unserem Denken, Urteilen und Handeln überhaupt auf Erwägungen
der Moral einlassen sollen. Wie könnte eine solche außermoralische
Rechtfertigung aussehen? Es
scheint sich hier um zwei Fragen handeln. Erstens, warum sollte sich die Gesellschaft
eine
Institution wie die Moral zu eigen machen? Warum sollte sie zur
Verhaltenssteuerung neben Konvention, Recht und Eigeninteresse auch ein System
der Moral aufbauen und fördern? Die Antwort liegt auf der Hand: Ohne ein
solches System dürften kaum zufriedenstellende Bedingungen für ein
menschliches Zusammenleben in der Gemeinschaft gegeben sein. Die Alternative wäre
entweder ein Naturzustand, in dem es allen oder doch den meisten von uns sehr
viel schlechter ginge als in unserem gegenwärtigen Zustand (selbst wenn Hobbes
unrecht haben sollte, daß im Naturzustand das Leben „einsam, armselig,
gemein, roh und kurz" wäre), oder aber ein staatlicher Leviathan, totalitärer
als alle bisherigen Formen des Staates, in dem das Recht alle Lebensbereiche
erfassen würde und in dem Gewalt und Drohung jede denkbare Verhaltensabweichung
des einzelnen unmöglich machen würden. Die zweite Frage betrifft die außermoralischen
Gründe (nicht bloß die Motive), die es für den einzelnen
gibt,
moralisch zu denken und zu handeln. Die Antwort wurde soeben gegeben, aber nur
bis zu einem gewissen Grad. Denn bei der Lektüre des letzten Absatzes könnte
jemand sagen: ,Ja, das zeigt, daß die Gesellschaft eine Moral braucht, und
auch, daß es für mich von Vorteil ist, wenn die arideren sich in ihrem
Verhalten von der Moral leiten lassen. Aber es zeigt nicht, daß ich moralisch leben sollte. Und es hat keine Zweck, mir
moralische Gründe dafür zu geben, daß ich es sollte. Was ich will, ist eine
außermoralische Rechtfertigung." Nun, wenn das bedeutet, daß unser Freund
gezeigt haben möchte, daß es für ihn stets von Nutzen ist - das heißt, daß
sein Leben in allen Belangen (im außermoralischen Sinn) besser oder zumindest
nicht schlechter sein wird-, wenn er sich in seiner gesamten Lebensführung an
der Moral orientiert, dann bezweifle ich, daß man seinem Ansinnen entsprechen
kann. Es gibt zwar eine Reihe bekannter Argumente, durch die man zeigen kann, daß
ein moralisches Leben mit einiger Wahrscheinlichkeit für ihn von Vorteil ist;
man muß aber in aller Offenheit zugeben, daß jemand, der den Weg der Moral
geht, unter Umständen Opfer bringen muß und daher im außermoralischen Sinn
vielleicht kein so gutes Leben hat, wie er andernfalls hätte. Wir
müssen uns an dieser Stelle daran erinnern, daß moralisch gutes oder richtiges
Handeln eine der überragenden Tätigkeiten ist und daher zu den Hauptkandidaten
zählt, wenn es um die Bestimmung der verschiedenen Komponenten des guten Lebens
geht - insbesondere da zu dieser überragenden Tätigkeit alle normalen Menschen
fähig sind. Mir scheint, daß dies ein für die Beantwortung unserer gegenwärtigen
Frage wichtiger Gesichtspunkt ist. Selbst wenn wir ihn den üblichen Argumenten
an die Seite stellen, besitzen wir jedoch noch immer keinen schlüssigen Beweis,
daß jedermann stets das moralisch Beste tun sollte (im außermoralischen Sinn
von „sollen", wie er hier zur Debatte steht). Denn vom
Klugheitsstandpunkt aus betrachtet könnten, soweit ich sehen kann, einige Leute
durchaus ein außermoralisch besseres Leben haben, wenn sie bisweilen das tun,
was im moralischen Sinn nicht das Beste ist - etwa in Fällen, in denen die
Moral ein beträchtliches Maß an Selbstaufopferung verlangt. Ein
Fernsehsprecher sagte einmal über jemanden „He was too good for his own
good", und mir scheint, daß dies manchmal zutreffen kann. Daraus
folgt nicht, daß sich die Institution der Moral gegenüber dem Individuum nicht
rechtfertigen ließe (wenngleich
eine Rechtfertigung einigen Individuen gegenüber nicht gelingen mag), denn eine
außermoralische Rechtfertigung
ist nicht notwendig an Gesichtspunkten des Egoismus oder der Klugheit
orientiert. Wenn A den B fragt, warum er (A) moralisch sein sollte, so kann B
den A auffordern, sich auf rationale Weise darüber klar zu werden, was für
eine Art von Leben er führen und was für ein Mensch er sein möchte. Das heißt,
er kann A fragen, was für ein Leben er wählen würde, wenn seine Wahl rational
- also frei von Zwang, unvoreingenommen und in voller Kenntnis der verschiedenen
alternativen Lebensformen (einschließlich der moralischen) - zustande käme. Vielleicht
kann B den A auf diese Weise überzeugen, daß unter Berücksichtigung aller
Umstände ein Leben unter Einbeziehung der Moral den Vorzug verdient. Wenn ja,
dann ist es ihm gelungen, die moralische Lebensform gegenüber A zu
rechtfertigen. Es mag sogar sein, daß A, wenn er die Dinge in dieser Weise
betrachtet, ein Leben für sich vorzieht, das auch Opfer einschließt. Natürlich
kann A sich weigern, in dem genannten Sinn rational zu sein. Er kann sagen:
„Aber warum sollte ich rational sein?" Doch wenn das von Anfang an seine
Haltung war, dann war es sinnlos von ihm, eine Rechtfertigung zu verlangen.
Rechtfertigung kann man nur dann wollen, wenn man bereit ist, rational zu sein.
Man widerspricht sich selbst, wenn man nach Gründen fragt,, ohne bereit zu
sein, Gründe irgendwelcher Art auch anzunehmen. Selbst mit der Frage „Warum
sollte ich rational sein?" verpflichtet man sich implizit zur Rationalität.
Denn eine solche Verpflichtung ist zumindest Teil der Bedeutung des Wortes
„sollen". Was für ein Leben A wählen würde, wenn er in jeder 3eziehung
rational und über sich und die Welt voll informiert wäre, hängt natürlich
davon ab, was für ein Mensch er ist (und die Menschen sind nicht alle gleich).
Wenn aber der psychologische Egoismus auf keinen von ms zutrifft, dann läßt es
sich nie ausschließen, daß A sich unter den genannten Bedingungen für eine
Lebensform entscheiden würde, die moralisch ist. Bertrand Russell schrieb in
diesem Zusammenhang einmal: „Wir laben Interessen, die nicht rein persönlicher
Natur sind. Das Leben, das die meisten von uns bewundern, ist ein Leben, das von
umfassenden, überpersönlichen Interessen bestimmt wird. Unsere Interessen sind
tatsächlich weniger eng und egoistisch, als viele Moralisten annehmen." Vielleicht
hat A noch eine weitere Frage: „Ist die Gesellschaft berechtigt, von mir
moralisches Verhalten zu verlangen und mich im Weigerungsfall zu tadeln oder zu
strafen?" Das aber ist eine moralische Frage. Und A kann
kaum erwarten, daß man der Gesellschaft eine solche Berechtigung nur dann
zugesteht, wenn sie zeigen kann,
daß ihr Vorgehen für A von Vorteil ist. Wenn A fragt, ob die Gesellschaft
moralisch berechtigt ist, von ihm zumindest ein gewisses Minimum an moralischer
Lebensführung zu verlangen, dann lautet die Antwort bestimmt positiv, wie wir
schon sahen. Allerdings muß die Gesellschaft hier Zurückhaltung üben. Denn
sie unterliegt selbst der moralischen Forderung, Autonomie und Freiheit des
einzelnen zu respektieren und ihn ganz allgemein gerecht zu behandeln. Und sie
darf nicht vergessen, daß die Moral die Funktion hat, das gute Leben der
einzelnen zu fördern und es nicht mehr als nötig zu stören. Die Moral ist für
den Menschen da, nicht der Mensch für die Moral. (William K. Frankena, Warum moralisch sein? Übers, v.
Norbert Hoerster. Aus: Dieter Birnbacher (Hrsg.), Texte zur Ethik. © für die
deutsche Übersetzung: 1987 Deutscher Taschenbuch Verlag, München) Aufgaben: 1.
Der Text
stellt zwei Fragen: Warum sollte eine Gesellschaft auf Moral bestehen und: warum
sollte der 2.Zeigen
Sie, in welchen Schritten gegen die Einwände der Person A im Text argumentiert
wird. 3.Versuchen
Sie, die Titelfrage des Texts für sich selbst zu beantworten. 4.Wo
zeigen sich Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede zwischen Ihrer eigenen Einschätzung
und M9
Antworten auf die W-Frage (Kurt
Bayertz, Hg, Warum moralisch sein?, Paderborn 2002, S. 32 f.) 1.Die
Frage, warum man moralisch sein soll, klingt ungewöhnlich und provokativ. Dies
liegt daran, dass die Vermutung nahe liegt, hinter dem ,Warum' verberge sich in
Wahrheit ein ,Ob'. In der sozialen Realität aber ist es niemandem freigestellt,
diese Frage nach seinem privaten gusto zu beantworten. Jede Gesellschaft übt
einen nicht unerheblichen Druck auf ihre Mitglieder aus, mora- lisch
zu sein. Verstöße gegen die Moral werden sanktioniert und in einigen besonders
wichtigen Fällen (die im Strafgesetzbuch aufgeführt werden) sind die
Sanktionen sogar institutionalisiert. Aus der
Perspektive der Gesellschaft ist die Moral so wichtig, daß bereits das
ernsthafte Stellen der Frage als ungehörig empfunden werden kann. 2.
Dieser (legitime) soziale Druck ändert nichts daran, daß sich die W-Frage
jeder handelnden Person zumindest
gelegentlich geradezu aufdrängt. Vor dem Hintergrund der strukturellen Spannung
zwischen dem Selbstinteresse der Individuen und den Forderungen der Moral wird
sie sich fragen, warum sie etwas tun soll, was ihren Interessen widerspricht.
Aus der Perspektive der ersten Person ist die W-Frage alles andere als sinnlos. 3.
Es gibt mehrere Antworten auf die W-Frage. Zumindest einige von ihnen geben gute
Gründe dafür an, moralisch zu sein. Der Hinweis auf das gemeinsame Interesse
aller oder die Aufforderung zu einem hypothetischen Rollentausch (wie ihn die
Goldene Regel vorschreibt) bieten solche guten Gründe. Überzeugungskraft
werden sie allerdings nur für diejenigen besitzen, die keine grundsätzlich
egoistische Haltung einnehmen und der Moral gegenüber offen sind. Es ist daher
stets zu beachten, von welcher Position aus die W-Frage gestellt wird. 4.
In der philosophischen Diskussion wird die W-Frage meist in einem radikaleren
Sinne interpretiert: Als
Frage eines Individuums, das nur an seinem eigenen Wohlergehen interessiert ist.
Da für ein solches Individuum grundsätzlich nur Klugheitsgründe zählen,
lauft die Aufgabe nun auf den (scheinbar paradoxen) Nachweis hinaus, daß es im
eigenen Interesse ist, den eigenen Interessen nicht immer die Priorität einzuräumen.
Dieser Nachweis aber läßt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen führen,
die nicht allgemein gegeben sind. Gegen den Amoralismus gibt es kein
'durchschlagendes' oder .zwingendes' Argument. 5.
Der Egoismus und die Gleichgültigkeit gegenüber den Forderungen der Moral ist
und bleiben für jeden Handelnden eine Option, die durch kein Argument beseitigt
werden kann. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die triviale Einsicht, daß
Argumente niemals einen faktisch-materiellen Zwang ausüben können; auch einen
rationalen Zwang durch Argumente gibt es nicht: Es ist nicht notwendigerweise
irrational, bei günstiger Gelegenheit unmoralisch zu handeln. Aus der Sicht der
Gesellschaft bedeutet dies, daß es unklug wäre, sich auf die Moralität der
Individuen allein zu verlassen. Im Hinblick auf diejenigen, die moralischen
Argumenten nicht zugänglich sind, muß sie sich (formelle wie informelle)
Sanktionen vorbehalten. Vor allem aber sollte sie ihre Strukturen so einrichten,
daß einerseits die ,günstigen Gelegenheiten' zum Unmoralisch-Sein möglichst
rar bleiben, und daß sich andererseits moralisches Handeln ,lohnt'. Fragen: 1.
Welche möglichen Antworten auf die 'W-Frage' bietet der Text an? 2.
Wie hängen Egoismus und Moralbegründung zusammen? 3.
Ist es stets vernünftig, moralisch zu sein? Wie sieht das der Text? 4.
Können Sie sich dem Ergebnis des Text (unter 5.)
anschließen? Diskutieren Sie. 5.
M10 Ethik des Kontraktualismus (Aus
: Konrad Ott, Moralbegründungen, Dresden 2 0 0 1 , S, 123 f.) Für
den Kontraktualismus entstehen Verpflichtungen aus Vereinbarungen (Verträgen,
Abmachungen). Normen, Regeln und Institutionen gelten, sofern sie Ergebnis eines
hypothetischen oder realen Gesellschaftsvertrages sind. Eine normative Ordnung
ist in dieser Ethiktheorie nicht vorgegeben, sondern gilt nur, insofern
strategisch-rational eingestellte Akteure sich auf sie einigen können. Andere
Quellen moralischer oder rechtlicher Verpflichtungen existieren nicht. Das
Moment der Einigung verweist auf eine (oberflächliche) Ähnlichkeit zwischen
Kontraktualismus und Diskursethik. Die Einigung wird jedoch im Kontraktualismus
im Unterschied zur Diskursethik nach dem Modell des Abschlusses eines Vertrages
konzipiert, durch den die Vertragsparteien einander Rechtstitel einräumen und
entsprechende Pflichten übernehmen. Niemand ist verpflichtet, einen Vertrag zu
schließen, wenn er dies als für sich ungünstig ablehnt, da vertragsvorgängige
Verpflichtungen nicht existieren. Man kann aus unterschiedlichen und aus
beliebigen Gründen und Motiven einer Abmachung zustimmen. Die Gründe, können
rein prudentieller Natur sein; eine Konzeption moralischer Einsicht ist unnötig.
Ein paradigmatischer Grund ist die Angst, u.U. böswilligen
Personen schutzlos ausgeliefert zu sein. Die Stärken des Kontraktualismus
liegen in seinen schwachen? Prämissen und in seiner Betonung des
Individualismus. Das zugrunde gelegte Menschenbild ist eher pessimistisch. Jeder
möchte seinen Nutzen maximieren, aber da dies für alle gilt, muß man sich
klugerweise miteinander arrangieren. Eine Art »Moralität« soll sich: auf
rationale Weise aus Amoralität ergeben. Der Kontraktualismus ist daher
prudentiell, interessenorientiert, individualistisch und wertskeptisch. Häufig
wird gesagt, dieses ethische Begründungsprogramm sei das einzige; das unter
modernen Bedingungen noch übrigbleibe. Thomas
Hobbes ist der Begründer des Kontraktualismus.B5 In
der von Hobbes ausgehenden Tradition möchte
man zeigen, dass die allgemeine Befolgung eines Sets von Regeln im
Eigeninteresse egoistischer, aber rationaler Subjekte liegt, die aus der
(fiktiven) Ausgangssituation des »Naturzustandes«, der sich für alle als
unerträglich erweist, hinausgelangen wollen. Der
(bei Hobbes hypothetische) Vertrag beendet den Naturzustand, den
anarchisch-freien »bellum omnium contra omnes« (Hobbes), in dem das
menschliche Leben kurz, hart und gemein ist. Fragen: 1.
Wie begründet der Kontraktualismus die Gültigkeit von Normen? 2.
Der Text behauptet, der Kontraktualismus sei "das einzige Begründungsprogramm,
das unter modernen -
Wie lässt sich diese Einschätzung vom Text her begründen? 3.
Mit welchen Überlegungen könnte man der Einschätzung widersprechen? M11
Vorzüge des Kontraktualismus (Aus:
Ernst Tugendhat, Aufsätze 1992-2000, Frankfurt/M. 2001, S. 172f.) In
Wirklichkeit ist aber der Ansatz des Kontraktualismus der einzig natürliche für
eine autonome Moral: Da eine
Moral in einem System wechselseitiger Forderungen besteht, ist eine autonom begründete
Moral überhaupt nur so denkbar, daß sich die Individuen fragen, welche
wechselseitigen Forderungen sie sich gegenseitig begründen können. Zur Begründung
kann nicht irgendeine Instanz außerhalb des Wollens der Individuen herangezogen
werden, weder eine Autorität noch eine angeblich reine Vernunft, noch sonst ein
Rekurs wie z. B. der auf eine wie immer bestimmte Natur des Menschen oder auf
die Gene. Und Autonomie kann hier natürlich nicht wie bei Kant Autonomie des
einzelnen heißen, sondern nur wechselseitige Autonomie, d. h. daß jeder dem
Willen aller anderen ein so großes Gewicht gibt wie seinem eigenen. Man
kann sich diesen kontraktualistischen Ansatz wieder an Hand der Frage
verdeutlichen, die ein Kind an seine
Eltern stellen könnte. Nachdem sich im Gespräch des Kindes mit den Eltern die
autoritären Normen als unbegründet
herausgestellt haben, können die Eltern nur noch auf den Willen des Kindes
rekurrieren. Sie können ihm sagen: Soll es nun also, wenn es nach dir ginge,
gar keine wechselseitigen Forderungen mehr geben, oder möchtest du auch von dir
aus, daß bestimmte Normen gelten? Dasselbe
möchten aber auch alle anderen, und du kannst nicht von den anderen erwarten,
daß sie sich deinen Forderungen
unterwerfen, wenn du dich ihnen nicht auch selbst unterwirfst. Wir müssen
daher, wenn wir wollen, daß die selbstgewollten Normen gelten, eine moralische
Gemeinschaft bilden, die darin besteht, daß wir dieses Set von Normen mittels
unserer Disposition zu Empörung und Schuld und einem durch sie bestimmten
Begriff der guten Person aufrechterhalten. »Es ist«, könnten die Eltern
hinzufügen, »schwer vorstellbar, daß es je eine menschliche Gemeinschaft ohne
diese Normen gegeben hat, und du kannst es dir also so denken, daß diese
autonome Moral immer auch schon einen Kernbestand innerhalb der historischen
autoritären Moralen bildete.« Fragen: 1.
Warum ist der Ansatz des Kontraktualismus "der einzig natürliche für eine
autonome Moral?" 2.
Welche Frage stellt wohl "das Kind" seinen Eltern, um sie zu einer
kontraktualistischen Begründung 3.
Mit welchen Argumenten könnte man di e Behauptung der Natürlichkeit des
Ansatzes bezweifeln? M12
Kritik des Kontraktualismus (Aus:
Ernst Tugendhat, Aufsätze 1992-2000., Frankfurt/M. 2001, S. 173 f.) Der
Kontraktualismus hat also einen einleuchtenden Ausgangspunkt. Aber es gibt Einwände. Ein
erster Einwand richtet sich gegen den im Kontraktualismus vorausgesetzten
Individualismus. Alle
Menschen sind von erster Kindheit an sozialisiert, sie stehen von vornherein in
normativen Verhältnissen,
und daher, so wird eingewandt, sei der im Kontraktualismus angenommene Naturzustand
vereinzelter Individuen eine Fiktion. Aber daß wir uns immer schon
vergesellschaftet und
in normativen Verhältnissen vorfinden, wird im recht verstandenen
Kontraktualismus gar nicht geleugnet,
sondern vorausgesetzt. Seine Frage ist vielmehr: Sind diese Verhältnisse
rechtens? Und d.h.:
Sind sie den Individuen selbst gegenüber begründbar? Es ist nur die Frage nach
der autonomen Begründung,
die den Naturzustand bloßer Individuen als Folie erzwingt. Er bildet den
Hintergrund für
die normative Idee, unter welchen Bedingungen die faktisch vorhandenen
normativen Verhältnisse als selbstgewollte verstanden werden können. Alle
normativen Gebilde, die einen Eigenwert beanspruchen und sich nicht auf den Wen
reduzieren lassen, den sie für die Individuen haben,
sind zu verwerfen. Ein zweiter Einwand besagt, der Kontraktualismus reduziere
alles Moralische auf Egoismus. Es gebe auch spontanen, auf Sympathie beruhenden
Altruismus. Der sich recht verstehende Kontraktualist bestreitet das nicht. Es
gibt einen nichtnormativen Altruismus gegenüber Personen, mit denen wir uns gefühlsmäßig
identifizieren, seien es Nahestehende oder auch alle Menschen oder sogar alle fühlenden
Wesen, aber dieser Altruismus ist kein moralischer, wenn wir Moral als System
von Normen, von wechselseitigen Forderungen verstehen. Man kann denjenigen
Altruismus, der moralisch geboten ist, nicht als Erweiterung der Sympathie
verstehen. Daß ein normativ gebotener Altruismus, dann, wenn er autonom
verstanden werden soll, egoistisch fundiert sein muß, schließt nicht aus, daß
es auch spontanen Altruismus gibt. Dem recht verstandenen kontraktualistischen
Ansatz zufolge kann ein autonom zu verstehendes normatives System nur egoistisch
überhaupt in Gang kommen, aber das schließt den spontanen Altruismus nicht nur
nicht aus, sondern muß dazu führen, daß dieser durch soziale Hochschätzung
in die Moral miteinbezogen wird. An diesen zweiten Einwand schließt sich leicht
ein dritter. Auch wer zugibt, daß man den moralischen
Altruismus vom sympathetischen unterscheiden muß, kann zweifeln, ob nicht die egoistische
Basis es dem Kontraktualismus unmöglich macht, die Ausbildung eines Gewissens verständlich
zu machen. Als Gewissen bezeichnet man diejenige innere Instanz, die einen davon abhält,
so zu handeln, wie man es für moralisch verboten ansieht. Wie kann, so läßt
sich fragen, bei einem
Konzept, das die Moral auf vormoralische Motive aufbaut, diese Instanz verständlich
werden? Man
wird das Vermögen zur Ausbildung der moralischen Gefühle - Empörung und
Schuld - als biologisch
vorgegeben ansehen müssen, sonst könnten sich Systeme sozialer Normen überhaupt nicht
ergeben. Fragen: 1.
Formulieren Sie die drei Einwände gegen den Kontraktualismus knapp in eigenen
Worten. 2.
Diskutieren Sie die Berechtigung der Einwände. 3.
Ist der Kontraktualismus mit diesen Einwänden als Moralbegründung widerlegt?
(von
Mich H. Werner) Der
Name „Diskursethik“ könnte zu der Auffassung verleiten, es handele sich bei
der so bezeichneten Ethik um eine
spezifische Ethik für Diskurse; um eine Bereichsethik also, die insofern mit
der Medizin-, Sport- oder Technikethik
vergleichbar sei. Dies wäre jedoch ein Missverständnis. Zumindest dem Anspruch
nach, den ihre Vertreter
mit ihr erheben, muss die Diskursethik als eine Konzeption der Allgemeinen Ethik
verstanden werden, die in dieser Hinsicht z.B. mit der Ethik Kants, dem
Kontraktualismus oder dem Utilitarismus zu vergleichen ist. Die Diskursethik
soll also nicht nur eine Antwort auf die Frage geben, wie wir innerhalb von
Diskursen richtig handeln, sondern sie soll klären, woran wir unser Handeln überhaupt,
in jeder Situation,
orientieren sollen. Ihren Namen „Diskursethik“ verdankt sie dem Umstand, daß
sie bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, in zweierlei Weise auf die
Praxis des argumentativen Diskurses Bezug nimmt. Erstens versucht sie, das
Moralprinzip, das – ähnlich dem Kategorischen Imperativ Kants – als der
oberste Orientierungspunkt allen Handelns verstanden wird, durch eine Reflexion
auf die (nach Ansicht der Diskursethiker) ‘unhintergehbare’ Praxis des
argumentativen Diskurses zu begründen. Zweitens besagt dieses Moralprinzip
seinerseits, daß genau diejenige Handlungsweise moralisch richtig ist, der alle
– insbesondere auch die Betroffenen – im Rahmen eines zwanglos geführten,
rein argumentativen Diskurses zustimmen könnten. Der Praxis des argumentativen
Diskurses kommt also sowohl bei der Begründung
des
Moralprinzips als auch bei der ‘Anwendung’ dieses Prinzips – besser
gesagt: bei der Orientierung
an diesem
Prinzip – eine entscheidende Bedeutung zu. Aus
dem Gesagten geht schon hervor, daß es sich bei der Diskursethik um eine formale
Prinzipienethik im
Sinne Kants handelt. Ethiken dieses Typs sehen ihre primäre Aufgabe in der
Formulierung und Begründung eines obersten Moralprinzips. Dieses Moralprinzip
ist nicht eine einfache Norm oder Handlungsregel, die uns unmittelbar
sagt, wie wir
– im Einzelfall oder in Situationen eines bestimmten Typs – handeln sollen.
Vielmehr stellt
es eine „Metanorm“ (Kuhlmann), eine höherstufige Methoden- oder
Verfahrensregel dar, die angibt, was überhaupt
eine moralisch richtige Norm, Maxime, Regel oder Handlungsweise auszeichnet und
wie wir einfache Normen, Maximen oder situationsspezifische Handlungsweisen
daraufhin prüfen können, ob sie moralisch richtig sind. Die
Diskursethik teilt mit der Ethik Kants nicht nur den prinzipienethischen
Charakter. Auch sonst kann sie als eine
kritische Neufassung bzw. „Transformation“ der Kantischen Ethik verstanden
werden. Ebenso wie die Ethik Kants ist die Diskursethik deontologisch. Das
bedeutet, daß das moralisch Richtige nicht lediglich als eine Funktion des
nichtmoralisch (evaluativ) Guten verstanden wird, wie dies beispielsweise im
Handlungsutilitarismus der Fall ist: Moralisch richtig ist nicht immer genau
diejenige Handlung, die zur Maximierung eines nichtmoralisch Guten – z.B. zur
maximalen Steigerung des Wohlbefindens oder zur Maximierung der Erfüllung
nichtmoralischer Präferenzen – beiträgt. Vielmehr wird im Rahmen der
Diskursethik, ähnlich wie in der Ethik Kants, die moralische Richtigkeit einer
Handlungsweise mit der rationalen Zustimmungsfähigkeit bzw. Akzeptabilität
dieser Handlungsweise (bzw. der Maxime oder Norm der jeweiligen Handlung)
gleichgesetzt. Als moralisch richtig gilt dabei, grob gesagt, diejenige
Handlungsweise, Maxime oder Norm, die wir, wenn wir vernünftig überlegen und
alle möglichen Konsequenzen sorgfältig ermessen, als Grundlage einer
allgemeinen Handlungsorientierung – d.h. als Grundlage der
Handlungsorientierung aller Handlungssubjekte in allen vergleichbaren
Situationen – wollen könnten. Dieses Kriterium moralischer Richtigkeit enthält
zwei wesentliche Grundideen, von denen die eine von der anderen voraussetzt
wird. Die erste Grundidee ist die der Selbstgesetzgebung bzw. Autonomie. Sie
kommt darin zur Geltung, daß die moralische Richtigkeit einer
Handlungsorientierung nicht durch einen fremden Willen – z.B.
die Autorität Gottes oder die Dezisionen eines staatlichen Souveräns –, oder
durch vermeintlich objektive Standards
– z.B. durch intrinsische Maßstäbe ‘der Natur’ – definiert wird.
Vielmehr hängt, was als moralisch richtig
gilt, letztlich von unserer eigenen Zustimmung ab. Die zweite Grundidee ist die
Idee der Verallgemeinerbarkeit im Sinne von Universalisierbarkeit. Sie ist in
der Idee der Autonomie insofern schon vorausgesetzt,
als sich eine rationale, d.h. auf gute Gründe gestützte Zustimmung ihrem Sinn
nach niemals exklusiv auf eine einzige, d.h. singuläre Handlung bzw. Situation,
sondern nur auf eine universelle Handlungsweise bzw. auf einen universellen
Situationstyp beziehen kann: Wenn Handlung H in Situation S rational akzeptabel
ist, so muß H auch in Situation S* akzeptabel sein, sofern S* in allen
(relevanten) Merkmalen mit S identisch ist. Versteht man Universalisierbarkeit
in diesem schwächeren Sinn, ist sie eine Konsistenzbedingung aller praktischen
Urteile. Die Forderung nach Universalisierbarkeit von Handlungsorientierungen
und -beurteilungen ist insofern ein konstitutives Element aller
kognitivistischen Ethiken. Das diskursethische Moralprinzip fordert allerdings
noch eine stärkere Form der Universalisierbarkeit. Das Kriterium der
Zustimmungsfähigkeit wird nämlich so verstanden, daß prinzipiell wir alle – d.h.: alle Vernunftwesen – eine Handlungsweise gleichermaßen
akzeptieren können müßten, wenn sie als moralisch richtig gelten können
soll. Auch in diesem stärkeren Sinne kann man von Universalisierbarkeit
sprechen. Universalisierbar in diesem Sinne sind praktische Urteile und
Handlungsorientierungen einzelner Moralsubjekte genau dann, wenn sie auch aus
der Perspektive aller anderen Moralsubjekte zustimmungsfähig sind. In diesem
Zusammenhang halten die Vertreter/innen der Diskursethik eine gewisse Revision
der Ethik Kants für nötig. Kant hatte angenommen, daß sich bei der Frage,
welche Maxime wir als allgemeine Handlungsorientierung wollen können, ein Übergang
vom „Ich“ zum „Wir“ sozusagen von selbst ergibt: Wenn ich nur aufrichtig
genug überlege, welche Maxime ich als allgemeines Gesetz wollen kann, so
bleiben Kant zufolge zwangsläufig genau diejenigen Maximen übrig, die auch
alle übrigen Moralsubjekte als allgemeines Gesetz wollen könnten. Die
Vertreter/innen der Diskursethik gehen hingegen davon aus, daß wir dasjenige,
was für uns alle gleichermaßen akzeptabel ist, nur im Zuge einer gemeinsamen
diskursiven Verständigung aufdecken bzw. als solches bekräftigen können.
Entsprechend rückt an die Stelle des Kategorischen Imperativs ein Diskurs- bzw.
Universalisierungsprinzip, das die moralische Richtigkeit von Handlungsweisen
davon abhängig macht, ob alle potentiellen
Argumentationspartner ihr zustimmen könnten. Literatur: Apel,
Karl-Otto (1973): Transformation
der Philosophie. Zwei Bände. Band 1: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik.
Band 2: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Habermas,
Jürgen (1996): »Eine genealogische Betrachtung zum kognitiven Gehalt des
Sollens.« In: Ders.: Die Einbeziehung
des Anderen: Studien zur politischen Philosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 11-64. Kuhlmann,
Wolfgang (1992): Kant
und die Transzendentalpragmatik. Würzburg: Königshausen & Neumann. M13
Die Rettung der Vernunft (von
Klaus Podak) Jürgen
Habermas hat ein unglaublich komplexes, kluges, reflektiertes, auch immer wieder
von ihm selbst korrigiertes,
weit verzweigtes Werk vorgelegt, das kaum auf einer Zeitungsseite verkürzt
dargestellt werden kann. Kommunikation heißt bei ihm nicht das, was die
technischen Medien uns unter diesem Titel in die Köpfe donnern wollen,
asymmetrisch: ohne die Chance zum Widerspruch. Kommunikation - Habermas'
wirklicher und wahrhaftiger Schlüsselbegriff - bedeutet die Möglichkeit der
Verständigung (und der Selbstverständigung) über das, was alle wollen könnten,
wollen müssten am Ende eines symmetrisch (also alle als gleichwertig akzeptierenden)
vollzogenen Kommunikationsprozesses. Der Begriff Kommunikation (und seine
Entfaltung) –in dieser herausragenden Position -reagiert auf Veränderungen
der Gesellschaftsentwicklung, nach denen die Gesellschaften
selbstreflexiv, also über sich selbst nachdenkend, ihre Geschichte und Zukunft
in den Griff bekommen
wollen. Kommunikation ist ein Geschehen zwischen (altmarxistisch) Basis und Überbau.
Nicht länger wird von den Produktionsverhältnissen alles bestimmt. Nicht länger
wird aus spekulativen Konstruktionen der Philosophie kritisch herabgesehen auf
den Alltagskram. [...] Das
alles spielt sich ab nach dem Ende der Metaphysik, also einer mit dem Anspruch
auf sichere Letztbegründung zwingenden, zwanghaften Philosophie. Aber - und das
ist sehr, sehr wichtig - dieses philosophische
Argumentieren landet auch nicht auf dem bunten Jahrmarkt postmoderner
Beliebigkeit, auf dem jeder
mal so sagt, was er für richtig oder opportun hält. Habermas ist ein
freundlich-strenger Diskussionspartner. Der
Sprache des Diskurses und der Debatten sind Regeln eingeschrieben, die, seiner
Meinung nach, kein bisschen willkürlich sind. Sie folgen, seiner Meinung nach,
der Logik einer Vernunft, die im Sprachhandeln der Diskutierenden
immer schon in Anspruch genommen werden, die als Hintergrundwissen unsere Verständigungen
leitet, die wir intuitiv schon immer anerkannt haben. Wir können uns nur verständigen,
weil wir hinterrücks von einer Vernunft geleitet werden, über die wir nicht
verfügen können, nicht verfügen müssen. Es ist die Logik der Sprache selbst,
die im Sprechhandeln realisiert wird. [...] Das
ist die Pointe des berühmten "linguistic turns", des Abstellens aller
Wahrheits- oder Richtigkeitsvermutungen und Zumutungen auf den Gebrauch von
Sprache in Verständigungsprozessen. Sprachgebrauch- also ein Geschehen, nicht
etwas als außer- oder überirdische Substanz Gedachtes -nimmt die Position des
Absoluten in der Geschichte ein. Ohne jedoch als absolut einfach gesetzt zu
werden. Sprachgeschehen ist da - als das alltäglich Selbstverständliche. Wir
reden, um uns zu einigen. Deshalb entfällt auch der klassisch-philosophische
Zwang zur Letztbegründung eines vermeintlich unerschütterlichen Fundaments.
Eigentlich ist die Umkehrung, die mit dem "linguistic turn "
eingeleitet worden ist, trivial. Vielleicht haben wir es gerade deshalb immer übersehen,
dass die Vernunft' in sprachlich vermittelten Verständigungsprozessen steckt.
Daraus folgt keineswegs, dass Vernunft nun schon eine immer vorhandene, gegebene
Größe wäre. Sie verbraucht sich in Verständigungsprozessen. Sie muss ständig
neu hergestellt werden in Verständigungsprozessen. Vernünftig sind wir nur,
wenn wir, ganz und gar im Konkreten, miteinander vernünftig sprechhandeIn. Das
kann misslingen. Absolute Sicherheit ist nirgends. So sieht - in der Sicht von
Habermas - Philosophie nach dem Ende der Metaphysik, nach dem Ende der "großen
Erzählungen " aus: fragil- aber zuverlässig. Bescheiden , trotzdem mit
universalistischem Anspruch auftretend. Denn die dem Miteinander-Sprechen
innewohnende Logik (Vernunft) gilt universal. [...] Diese hier nur skizzenhaft,
im Werk von Habermas subtil, ausführlich, lernbegierig entfaltete Argumentation
bildet die Basis für seine Vorstöße in die Welt der Tagespolitik: China und
SPD, Kosovo und Gentechnik: Denn im Alltag, gerade im politischen Alltag, muss
sie sich ja bewähren: die Theorie der Herstellung von Vernunft in Verständigungsprozessen.
Es geht nicht mehr um die Erklärung des Seienden im Ganzen in einem großen
Wurf. Es geht nunmehr um das Austesten vernünftiger Kommunikation. (Aus:
SZ am Wochenende, Süddeutsche Zeitung, 13/14. 10. 2001, S. 1 – Auszüge) Aufgaben: 1.
Welche Rolle spielt Kommunikation im Werk von Habermas? 2.
Welche Aufgaben erfüllt die Kommunikation? 3.
Wie hängen Kommunikation, Vernunft, Moralbegründung zusammen? 4.
"Wir können uns nur verständigen, weil wir hinterrücks von einer
Vernunft geleitet werden..." – Wie ist M14
Jürgen Habermas: Was heißt Diskursethik? (Aus:
J. Habermas, Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt/M. 1991, S11f) Lassen
Sie mich vorweg den deontologischen, kognitivistischen, formalistischen und
universalistischen Charakter der Kantischen Ethik erklären. Weil sich Kant auf
die Menge begründbarer normativer Urteile beschränken will, muß er einen
engen Moralbegriff zugrunde legen. Die klassischen Ethiken hatten sich auf alle
Fragen des „guten Lebens" bezogen; Kants Ethik bezieht sich nur noch auf
Probleme richtigen oder gerechten Handelns. Moralische Urteile erklären, wie
Handlungskonflikte auf der Grundlage eines rational motivierten Einverständnisses
beigelegt werden können. Im weiteren Sinne dienen sie dazu, Handlungen im
Lichte gültiger Normen oder die Gültigkeit der Normen im Lichte anerkennungswürdiger
Prinzipien zu rechtfertigen. Das moraltheoretisch erklärungsbedürftige Grundphänomen
ist nämlich die Sollgeltung von Geboten
oder Handlungsnormen. In dieser Hinsicht sprechen wir von einer deontologischen
Ethik. Diese versteht die Richtigkeit von Normen oder Geboten in Analogie zur
Wahrheit eines assertorischen Satzes. Allerdings darf die moralische
„Wahrheit" von Sollsätzen nicht - wie im Intuitionismus oder in der
Wertethik - an die assertorische Geltung von Aussagesätzen assimiliert werden.
Kant wirft die theoretische mit der praktischen Vernunft nicht zusammen.
Normative Richtigkeit begreife ich als wahrheitsanalogen Geltungsanspruch. In
diesem Sinne sprechen wir auch von einer kognitivistischen Ethik. Diese
muß die Frage beantworten können, wie sich normative Aussagen begründen
lassen. Obwohl Kant die Imperativform wählt („Handle nur nach derjenigen
Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz
werde!"), übernimmt der kategorische Imperativ die Rolle eines
Rechtfertigungsprinzips, welches verallgemeinerungsfähige Handlungsnormen als gültig
auszeichnet: was im moralischen Sinne gerechtfertigt ist, müssen alle vernünftigen
Wesen wollen können. In dieser Hinsicht sprechen wir von einer formalistischen
Ethik. In der Diskursethik tritt an die Stelle des Kategorischen Imperativs das
Verfahren der moralischen Argumentation. Sie stellt den Grundsatz ,D,' auf: -
daß nur diejenigen Normen Geltung beanspruchen dürfen,die die Zustimmung aller
Betroffenen als Teilnehmer einespraktischen Diskurses finden könnten. Zugleich
wird der Kategorische Imperativ zu einem Universalisierungsgrundsatz ,U'
herabgestuft, der in praktischen Diskursen die Rolle einer Argumentationsregel
übernimmt: -
bei gültigen Normen müssen Ergebnisse in den Nebenfolgen, die sich
voraussichtlich aus einer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der
Interessen eines jeden ergeben, von allen zwanglos akzeptiert werden können.
Universalistisch nennen wir schließlich eine Ethik, die behauptet, daß dieses
(oder ein ähnliches) Moralprinzip nicht nur die Intuitionen
einer bestimmten Kultur oder einer bestimmten Epoche ausdrückt, sondern
allgemein gilt. Nur eine Begründung des Moralprinzips, die ja nicht schon durch
den Hinweis auf ein Faktum der Vernunft geleistet wird, kann den Verdacht auf
einen ethnozentrischen Fehlschluß entkräften. Man muß nachweisen können, daß
unser Moralprinzip nicht nur die Vorurteile des erwachsenen, weißen, männlichen,
bürgerlich erzogenen Mitteleuropäers von heute widerspiegelt. Auf diesen
schwierigsten Teil der Ethik werde ich nicht eingehen, sondern nur die These in
Erinnerung bringen, die die Diskursethik in diesem Zusammenhang aufstellt:
Jeder, der ernsthaft den Versuch unternimmt, an einer Argumentation
teilzunehmen, läßt sich implizit auf allgemeine pragmatische Voraussetzungen
ein, die einen normativen Gehalt haben; das Moralprinzip läßt sich dann aus
dem Gehalt dieser Argumentationsvoraussetzungen ableiten, sofern man nur weiß,
was es heißt, eine Handlungsnorm zu rechtfertigen. Soviel zu den
deontologischen, kognitivistischen, formalistischen und universalistischen
Grundannahmen, die alle Ethiken des Kantischen Typs in der einen oder anderen
Version vertreten. Kurz erläutern möchte ich noch das in ,D' genannte
Verfahren des praktischen Diskurses. Den
Standpunkt, von dem aus moralische Fragen unparteilich beurteilt werden können,
nennen wir den „moralischen Gesichtspunkt" (moral point of view).
Formalistische Ethiken geben eine Regel an, die erklärt, wie man etwas unter
dem moralischen Gesichtspunkt betrachtet. John Rawls empfiehlt bekanntlich einen
Urzustand, in dem alle Beteiligten einander als rational entscheidende,
gleichberechtigte Vertragspartner, freilich in Unkenntnis über ihren tatsächlich
eingenommenen gesellschaftlichen Status gegenübertreten, als „den
angemessenen Ausgangszustand, der gewährleistet, daß die in ihm erzielten
Grundvereinbarungen fair sind". G. H. Mead empfiehlt statt dessen eine
ideale Rollenübernahme, die verlangt, daß sich das moralisch urteilende
Subjekt in die Lage all derer versetzt, die von der Ausführung einer
problematischen Handlung oder von
der Inkraftsetzung einer fraglichen Norm betroffen wären. Das Verfahren des
praktischen Diskurses hat Vorzüge gegenüber beiden Konstruktionen. In
Argumentationen müssen die Teilnehmer davon ausgehen, daß im Prinzip alle
Betroffenen als Freie und Gleiche an einer kooperativen Wahrheitssuche
teilnehmen, bei der einzig der Zwang des besseren Arguments zum Zuge kommen
darf. Der praktische Diskurs gilt als eine anspruchsvolle Form der
argumentativen Willensbildung, die (wie der Rawlssche Urzustand) allein aufgrund
allgemeiner Kommunikationsvoraussetzungen die Richtigkeit (oder Fairneß) jedes
unter diesen Bedingungen möglichen normativen Einverständnisses garantieren
soll. Diese Rolle kann der Diskurs kraft der idealisierenden Unterstellungen
spielen, die die Teilnehmer in ihrer Argumentationspraxis tatsächlich
vornehmen müssen; deshalb entfällt der fiktive Charakter des
Urzustandes einschließlich des Arrangements künstlicher Unwissenheit. Auf
der anderen Seite läßt sich der praktische Diskurs als ein Verständigungsprozeß
begreifen, der seiner Form nach alle Beteiligten gleichzeitig zur idealen Rollenübernahme
anhält. Er transformiert also die (bei Mead) von jedem einzeln und privat im
vorgenommene ideale Rollenübernahme in eine öffentliche, von allen
intersubjektiv gemeinsam praktizierte Veranstaltung. Aufgaben: formuliert
die Diskursethik das, was bei Kant 'kategorischer Imperativ' heißt? Wie begründet
Habermas die Überlegenheit des praktischen Diskurses über andere Möglichkeiten,
einen unparteilichen Standpunkt zu erreichen?
M15
Grundsätze und Regeln der Diskursethik 1.
"Statt allen anderen eine Maxime, von der ich will, dass sie ein
allgemeines Gesetz sei, als gültig vorzuschreiben,
muss ich meine Maxime zum Zweck der diskursiven Prüfung ihres Universalitätsanspruchs
allen anderen vorlegen. Das Gewicht verschiebt sich von dem, was jeder
(einzelne) ohne Widerspruch als allgemeines Gesetz wollen kann, auf das, was
alle in Übereinstimmung als universale Norm anerkennen wollen " (S. 77) Universalisierungsgrundsatz
(U) 2.
"So muss jede gültige Norm der Bedingung genügen, dass die Folgen und
Nebenwirkungen, die sich jeweils aus ihrer allgemeinen
Befolgung für
die Befriedigung der Interessen eines jeden Einzelnen (voraussichtlich) ergeben, von allen
Betroffenen
akzeptiert (und den Auswirkungen der bekannten alternativen Regelungsmöglichkeiten
vorgezogen) werden können." (S. 75f) Diskursethischer
Grundsatz (D) 3.
"Der Diskursethik zufolge darf eine Norm nur dann Geltung beanspruchen,
wenn alle von ihr möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer
eines praktischen Diskurses Einverständnis darüber erzielen, (bzw. erzielen würden)
dass diese Norm gilt." (S. 76) Regeln
für den praktischen Diskurs: 4.1:
"Kein Sprecher darf sich widersprechen. 4.2:
Jeder Sprecher, der ein Prädikat F auf einen Gegenstand a anwendet, muss bereit
sein, F auf jeden
anderen Gegenstand, der a in allen relevanten Hinsichten gleicht, anzuwenden. 4.3:
Verschiedene Sprecher dürfen den gleichen Ausdruck nicht mit verschiedenen
Bedeutungen benutzen."
(S. 97) 5.1:
"Jeder Sprecher darf nur das behaupten, was er selbst glaubt. 5.2:
Wer eine Aussage oder Norm, die nicht Gegenstand der Diskussion ist, angreift,
muss hier- für
einen Grund angeben." (S. 98) 6.1:
"Jedes sprach- und handlungsfähige Subjekt darf an Diskursen teilnehmen. 6.2:
Jeder darf jede Behauptung problematisieren. 6.3:
Jeder darf jede Behauptung in den Diskurs einführen. 6.4:
Jeder darf seine Einstellungen, Wünsche und Bedürfnisse äußern. 6.5:
Kein Sprecher darf durch innerhalb oder außerhalb des Diskurses herrschenden
Zwang daran
gehindert werden, seine obigen Rechte wahrzunehmen." (s. 99) (Aus:
J. Habermas, Diskursethik – Notizen zu einem Begründungsprogramm, in: Ders:
Moralbewusstsein und kommunikatives
Handeln, Frankfurt 1983, S. 53-126) Aufgaben: 1.
Inwiefern kritisiert die erste Aussage (1.) die Ethik Kants? 2.
Versuchen Sie, einen 'kategorischen Imperativ' zu formulieren, der die Idee der
Diskursethik ausdrückt. Berücksichtigen
Sie dabei auch die Regeln (U) und (D). 3.
Halten Sie die Diskursregeln (4.1-6.5) für ausreichend, um eine Diskussion zu führen,
in der das ethisch
Richtige und für alle Verbindliche als Ergebnis herauskommt? 4.
Welche Regeln fehlen? 5.
Kann es überhaupt einen Diskurs in der Praxis geben, der all diese Regeln einhält?
Kritisieren Sie die Regeln
unter dem Aspekt ihrer 'Machbarkeit'. 6.
Versuchen Sie, selbst einen Diskurs über ein ethisches Problem zu führen, der
all diese Regeln berück- sichtigt.
(Eine Kontrollgruppe sollte festhalten, welche Regeln gebrochen wurden.) M16
Gibt es moralische Normen, die niemand bestreiten kann? Diskursethische
Letztbegründung? (Aus:
Ethik und Unterricht, Heft 2, 1994, S. 19) Die
folgende Liste von widersprüchlichen Aussagen, sogenannte "performative
Selbstwidersprüche", könnte von einem radikalen Skeptiker behauptet
werden, der auf keinen Fall zugeben will , dass es irgend eine verbindliche
moralische Norm, bzw. irgend eine unbestreitbare Wahrheit gibt. Führen Sie in
Ihrer Klasse einen Diskurs, der das Ziel hat, den Skeptiker zur Aufgabe zu
bewegen: 1.
Teilen Sie Ihre Klasse in zwei Gruppen: 'Skeptiker' und 'Diskursethiker'. 2.
Die 'Skeptiker' verteilen die Aussagen aus der Liste unter sich. Jeder erfindet
eine konkrete Aussage, die
seinen Widerspruch enthält und vertritt sie gegen die andere Gruppe. 3.
Alle 'Diskursethiker' versuchen Ihn zu widerlegen. 4.
Diskutieren Sie so lange, bis alle Aussagen der 'Skeptiker' als Selbstwidersprüche
entlarvt sind. Performative
Selbstwidersprüche 1.
Widerspruchsfreiheit:
»Ein und
derselben Sache darf ein und dieselbe Aussage sehr wohl ausgesprochen
und in derselben Hinsicht (Beziehung) zugleich auch nicht zugesprochen werden.« Auf
Nachfrage (meinst du das wirklich?) müßte zugegeben und bekräftigt werden:
[Ich behaupte mit
dem Anspruch auf Richtigkeit:] »Ein und derselben ...« 2.
Sinngeltungsanspruch:
[Ich
behaupte mit Verständlichkeitsanspruch:] »Ich habe keinen Verständlichkeitsanspruch.« 3.
Wahrhaftigkeit:
[Ich behaupte
mit dem Anspruch auf Wahrheit:] »p, und p ist eine Lüge.« 4.
Freie
Akzeptierbarkeit:
[Ich behaupte
hiermit als intersubjektiv gültig (als durch jeden Diskussionspartner
frei akzeptierbar):] »Die Norm der freien Akzeptierbarkeit von p brauche ich nicht
anzuerkennen.« 5.
Zwanglosigkeit:
[Ich sage dir
mit dem Anspruch, dich allein durch die Kraft meiner Aussagen überzeugen
zu können]: Überzeugung ist nichts als eine scheinbar zwanglose Suggestion.« 6.
Gewaltfreiheit:
[Ich
erhebe den Anspruch, dich ohne Machteinsatz davon überzeugen zu können:]
»Aller Sprachgebrauch - auch die Argumentation — ist nichts als eine Machtpraktik.« 7.
Wahrheitsanspruch:
»Ich
behaupte als wahr, daß ich keinen Wahrheitsanspruch habe.« 8.
Selbstengagementfehler:
[Ich behaupte
allen Ernstes:] »p, und es ist mir völlig egal, daß p.« 9.
Begründungspflicht:
[Ich behaupte
mit guten Gründen:] »p, aber ich brauche p nicht zu begründen weder
jetzt noch später.« 10.
Gleichberechtigung:
[Ich behaupte
allen gegenüber als wahr:] »Ich brauche die Gleich- berechtigung
aller denkbaren Argumentationspartner nicht anzuerkennen." 11.
Selbstbindungsfehler:
[Ich
behaupte mit dem Anspruch, meine Gesprächspartner überzeugen zu
können, auch wenn alle dagegen reden könnten:] »p, und über p lasse ich
nicht mit mir reden.« 12.
Konsensbildung:
[Ich
vertrete als konsensfähig den Vorschlag:] »Wir sollen prinzipiell das Diskursziel
des Konsenses durch das des Dissenses ersetzen.« 13.
Ideale
Unbegrenzte Sprechsituation: »p,
und p würde die Ideale Unbegrenzte Kommunikationsgemeinschaft
niemals zustimmen.« Beispiel: [Ich behaupte euch gegenüber als
wahr:] »Meine Argumentationsweise gilt nicht für euch, sondern nur für Angehörige meines
Kulturkreises, meiner Religion usw.« M17
Was fordert die Diskursethik? Ein fiktives Interview (Aus:
Ethik und Unterricht, Heft 2, 1994, S. 26 f.) Aufgaben:
1. Lesen Sie das Interview mit verteilten Rollen.
2. Ergänzen Sie das Interview um weitere Zwischenfragen, die das Verständnis
erleichtern. 1.
Frage: Was ist
nach der Diskursethik oder Kommunikationsethik gutes, gerechtes Verhalten? Die
Grundnorm der Konsensbildungspflicht (Basisnorm I) lautet: »Wenn wir an der Lösung
eines praktischen Problems ernsthaft interessiert sind, eines Problems, in dem
es um die Berechtigung von Handlungsnormen, Zielen, Bedürfnissen, Interessen
geht, und dies insbesondere im Falle des Konflikts zwischen Ansprüchen
verschiedener Beteiligter, dann müssen wir uns um eine Lösung bemühen, der
jeder irgendwie Betroffene zustimmen könnte: wir müssen uns um einen vernünftigen
Konsens bemühen. Wobei »vernünftig«, wie wir erinnern wollen, heißen soll,
daß kein Zwang außer dem des besseren Arguments ausgeübt werden darf.«
(Formulierung von Wolfgang Kuhlmann) 2.
Frage: Die
Diskursethik gibt mir also keine direkte Antwort auf meine Frage, sondern
schreibt mir nur ein Verfahren vor? ja.
Die Diskursethik ist zweistufig. Wir müssen nämlich genau unterscheiden
zwischen den konkreten Handlungsnormen (2.. Stufe), die uns sagen, was wir hier
und jetzt tun sollen, und den Basisnormen (1. Stufe), auf deren Grundlage die
konkreten Handlungsnormen aller erst herausgefunden werden können. Die
wichtigste Basisnorm ist die eben genannte »Grundnorm der
Konsensbildungspflicht«. 3.
Frage: Aber
der Dialog mit den Betroffenen ist doch in den meisten Fällen gar nicht möglich? Aber
in den wichtigsten Fällen! Sonst gilt der Zusatz zu Basisnorm I: Handle auch in
einsamer Entscheidung wenigstens nach einer konsensfähigen Handlungsnorm! 4.
Frage: Kann
man das alles nicht kürzer sagen? Doch:
Handle so, daß deiner Handlung alle von dieser Handlung möglicherweise
Betroffenen tatsächlich zwanglos zugestimmt haben oder doch wenigstens
zustimmen würden! 5.
Frage: Dann wäre
ja der Diskurs das oberste Gebot bei allen Interessenkonflikten. Denn nur, wenn
alle Vormeinungenund Entscheidungen angezweifelt und Rechtfertigungen für alles
verlangt werden dürfen, kommt es zu einem tatsächlichen Konsens. So ein
sokratischer Dialog aber heißt heute Diskurs und ist utopisch. Die Realität,
die ist eben nicht so —
oder? Richtig.
Deshalb sollten wir uns nach der Diskursethik für die Herstellung der
Anwendungsbedingungen der Grundnorm einsetzen, d.h. gewaltlos für die
Realisierung zwangloser, demokratischer Kommunikation unter allen Menschen kämpfen.
Dies besagt die Basisnorm II der Realisierungspflicht: Bemühe dich stets darum,
zur langfristigen Realisierung solcher Verhältnisse beizutragen, die der
Realisierung der idealen Kommunikationsgemeinschaft näher kommen! (Karl-Otto
Apel) 6.
Frage: Gilt
das Gebot der gewaltlosen Kommunikation ausnahmslos, oder gibt es auch ein Recht
auf Selbstverteidigung? Es
gibt immer Realitäten, die auf dem Weg zur Idealen Unbegrenzten
Kommunikations-Gemeinschaft: liegen: Zunächst
alle Menschen, ferner alle wahrhaft demokratischen und wissenschaftlichen
Traditionen sowie die noch(!)
existierenden ökologischen Bedingungen fiir höhere Lebewesen auf der Erde. Wir
haben die Pflicht,
diese Realitäten zu bewahren und jede Verständigungsorientierte
Kommunikationsgemeinschaft (Abk.:
VKG) zu schützen; z.B. meine ich, wir haben die Pflicht, als Bürger hier auf
Mitsprache (Partizipation)
zu bestehen. Dies besagt für uns die Basisnorm III, die »Bewahrung«- und
Schutzpflicht«: »Trage
stets dafür Sorge, daß die schon existierenden Bedingungen der möglichen
Realisierung einer idealen
Kommunikationsgemeinschaft — so die biologische Existenz der realen
menschlichen Kommunikations-Gemeinschaften
und die Existenz der kulturellen Voraussetzungen (der idealen Kommunikationsgemeinschaft)
- gewahrt werden!« (Karl-Otto Apel) Dies bedeutet z.B.: Im Falle physischer Bedrohung
unterdrückter Menschengruppen gibt es für diese Gruppen, wenn es sich um VKGs
handelt, ein
Widerstandsrecht. 7.
Frage: Gut,
dies ist eine Ethik. Aber aus welchen Gründen sollte ich überhaupt ethisch
handeln ? Warum sollte ich das alles befolgen? Aus
egoistischen Gründen: Um zu überleben! Daß heutzutage viele praktische
Probleme in ihrer Komplexität
lebensbedrohliche Dimensionen angenommen haben, zeigen Daten und Prognosen zur ökologischen
Situation. Um »Wege aus der Gefahr« zu finden, bedarf es der Mithilfe aller.
Zur Veranschaulichung:
In einem Bericht des World-watch-Instituts Washington steht, daß in 100 Jahren
möglicherweise nur noch 50 % der »Naturvölker« existieren werden. Diese besäßen
aber ein »unschätzbares Wissen über das weltweite Ökosystem«, das der
ganzen Menschheit zugute komme. Millionen Pflanzen- und Tierarten
würde es nicht mehr geben, wenn ihre Kulturen den herrschenden Kulturen
untergeordnet oder ausgerottet
würden (Frankfurter Rundschau vom 14.12.92). Außerdem meine ich, daß wir von
diesen Kulturen
vielleicht etwas für unser Lebensglück lernen können. 8.
Frage: Schön,
wir sollen uns auf der Basis unserer »wahren« Bedürfnisse oder Interessen
oder Vorteile mit allen
einigen. Es wäre schön, wenn dies allgemeine Orientierung würde. Aber
innerhalb des Diskurses kommt dann
doch wieder das alte Problem des Utilitarismus, das Maßstabsproblem: Was ist für
den Menschen nützlich, vorteilhaft oder von »wahrem Interesse«? Die Maßstäbe
dafür kann doch jeder nur in sich selber suchen und finden? Richtig.
Die Kommunikationsethik kann und darf keine Maßstäbe vorgeben, wohl aber gibt
sie Rahmenkriterien
für jede mögliche Konsensbildung vor: Ethisch richtig kann doch nur sein, was
den Diskursregeln
und den drei Basisnormen nicht widerspricht, sonst würden wir uns ja um die Möglichkeit bringen,
das Richtige mit den anderen herauszufinden. Die
Postmoderne bezieht auch in der Ethik eine radikal-skeptische Position. Ihr
Schwerpunkt liegt hier allerdings nicht. Mit
einer Ausnahme: Emmanuel Lévinas (1906-1995) denkt die gesamte Philosophie von
der Ethik her, für ihn ist Ethik eine "Erste Philosophie". Er sieht
als Grundzug der gesamten abendländischen Philosophie ein gestörtes Verhältnis
zum Anderen: das Andere wird als solches nicht ertragen, wird vereinnahmt, dem
Maßstab des subjektiven Blicks gebeugt, sein Geheimnis wird als Bedrohung
empfunden, sein Rätsel muss gelüftet werden, da wir gewohnt sind, vom Ich, vom
eigenen Bewusstsein aus zu denken und dieser Perspektive alles unterzuordnen.
Das Ich wird, spätestens seit Descartes, absolut gesetzt: "...dabei
verliert das Andere seine Andersheit. Von ihrem Beginn an ist die Philosophie
vom Entsetzen vor dem Anderen,
das Anderes bleibt, ergriffen...durch alle Abenteuer hindurch findet sich das
Bewusstsein als es selbst wieder,
es kehrt zu sich zurück, wie Odysseus, der bei allen seinen Fahrten nur auf
seine Geburtsinsel zugeht." (Lévinas,
87, S. 212) Dieser
Vergötzung der Autonomie, diesem selbst-bewussten Blick auf den Anderen, die
das menschliche Denken verengen und dem Bewusstsein alles Spontane, Offene
verbieten, setzt Lévinas die Utopie einer "Ethik des Anderen"
entgegen, einen radikalen Altruismus, der im Perspektivenwechsel, in der
konsequenten Verantwortung für den Anderen, die nicht etwa "übernommen"
wird, sondern da ist, als sei sie "immer schon" vorhanden, die
Bedingung dafür sieht, dass die Menschen zu sich finden können: "Die
Menschlichkeit des Menschen – das wahre Leben – ist (noch) abwesend....Der
eigentliche Durchbruch des Subjektiven, das ist das Sein, das sich seiner
eigenen Seinsbedingungen entledigt: Selbstlosigkeit" (Lévinas,
87, S.77) Damit
knüpft Lévinas zwar an der Bewusstseins-Kritik Nietzsches und Heideggers an,
wendet sie aber – utopisch – ins Positive: der "Wille zur Macht"
oder das Ende des "Humanismus" als letzte Übersteigerungen eines
selbstbewussten Denkens, können überwunden werden, wenn eben diese
Konzentration auf das Selbstbewusstsein abgelöst wird durch die Hinwendung zum
Anderen. Die
meisten postmodernen Philosophen äußern sich zu ethischen Fragen allerdings
eher am Rande und eher kritisch
gegenüber Fundierungstheorien denn konstruktiv. Eine Begründung, gar Letztbegründung,
von Moral diesseits
der jenseitigen erscheint ihr hoffnungslos; mit dem Tod Gottes stirbt die
einzige glaubwürdige Autorität jedes Gültigkeitsanspruchs von Moral, alle
profanen Versuche, dieses Glaubwürdigkeits-Vakuum zu füllen, müssen scheitern
oder fallen in religiöse Begründung zurück. Die
Diskursethik, als modernste Variante eines solchen säkularen
'Rettungsversuchs', wird von der Postmodernen vor allem mit zwei Einwänden
konfrontiert. Erstens:
Ziel der Diskurse sei in Wahrheit nicht der Konsens, auf den sich die
Diskursteilnehmer einigten, vielmehr der Dissens, der Widerstreit ("le différend"
/ Lyotard). Die Vorstellung eines Konsensus sei zu harmonistisch und, da,
angesichts der Heterogenität der Teilnehmerinteressen, nicht wirklich zwanglos
realisierbar, zuletzt gewalttätig. Der
Konsens sei nur ein Zwischenstadium, am Ende münde jeder Diskurs in der
Paralogie. Zweitens:
Die Bedingung, dass die Diskursteilnehmer "sagen, was sie meinen" (Habermas)
sei, jenseits des schieren
Verbots von Lüge und Täuschung, uneinlösbar. Sie geht von einer
Referenztheorie von Sprache aus, die die Komplexität des Verhältnisses von
Semantik und Pragmatik unterschätzt: Die Bedeutung von Begriffen bildet, verändert,
überformt sich in der konkreten Sprachverwendung dergestalt, dass es unmöglich
scheint, a priori ein fixes Verhältnis von Aussage (sagen) und Bedeutung
(meinen) festzuschreiben. Und: selbst wenn ich sagen könnte, was ich meine,
bleibt fraglich, ob der Hörer versteht, was ich meine, mit dem, was ich sage.
Zudem unterstellt die Referenztheorie eine unhaltbare metaphysische Ordnung von
Dingen und zugeordneten Begriffen: Um Rousseaus Körper-Metapher zu verstehen,
brauche ich aber nicht die Annahme, dass die Begriffe "Kopf" und Körper"
sich zueinander verhalten wie ein Kopf und ein Körper, es genügt zu wissen,
wie die Begriffe gemeinhin verwendet werden. Sprache ist kein Instrument, die
Welt abzubilden, sondern ein Signum des Menschlichen. Weit
besser als "Postmoderne Ethik", wie Z. Bauman sein Buch – die
bislang einzige einschlägige Monographie nennt, würde Lyotards Titel
"Postmoderne Moralitäten" zu dem Werk passen, da es alle Ethik
verwirft und auf die Pluralität von Moral verweist. In folgenden Schritten
entwickelt er seine Konzeption. (Vgl.
Z. Bauman, Postmoderne Ethik, Wien 1995, S. 5-35) 1.)
Der Mensch ist ein moralisch ambivalentes Wesen. Diese Ambivalenz ist
unaufhebbar, alle Versuche, den moralisch-besseren
Menschen zu erziehen, münden in Gesinnungsdiktatur, Tugendterror und
Grausamkeit. Es gibt keine Garantie für Moralität, sie ist eine existentielle
Unmöglichkeit, wer sie erstrebt, verschlimmert nur die Lage. 2.)
Moral ist "inhärent nicht-rational". Sie zeigt sich weder aus
utilitaristischem Kalkül, folgt keinen Zweck- und Nützlichkeitserwägungen,
noch ist sie Prinzipien- oder Maximen-geleitet. Nicht aus Lust, noch aus Pflicht
handeln wir moralisch, sondern aus spontanem Impuls. Das autonome moralische
Gewissen eines Jeden ist nicht einklagbar, mal schlägt es, mal schweigt es. 3.)
Ethik irritiert nur die Moral. Sie nutzt den spontanen moralischen Impuls für
ihre Steuerungs-absichten, will ihn zügeln, zähmen, dirigieren – und zerstört
ihn dadurch. Sie verschiebt Moral aus dem Bereich persönlicher Autonomie
in machtgestützte Heteronomie, sie will erlernbare Regeln, ethisches Wissen an
die Stelle subjektiver moralischer Verantwortung setzen und sieht nicht, dass
Moral das Chaotische ist, inmitten einer rationalen Ordnung. 4.)
Moralität ist aporetisch. Die Folgen moralischer Handlungen sind fast stets
uneindeutig, widersprüchlich. Selten sind moralische Handlungen eindeutig gut,
meist hingegen ein Abwägen im Konfliktfall, was negative Folgen einschließt.
Daher auch unsere Unsicherheit, wenn wir moralisch handeln. So kann etwa selbst
vermeintlich so eindeutig Gutes, wie Hilfsbereitschaft in Abhängigkeit und
Beherrschung des Hilfesuchenden umschlagen. 5.)
Moral ist nicht universalisierbar. Das heißt nicht, dass sie vollkommen
relativ, beliebig ist, wohl aber stülpt der Universalismus in seiner bekannten
Form einen ethischen
Code über alle,
versucht die moralische Gleichschaltung, die Verallgemeinerung einer einzigen,
westlichen Moral – und erreicht damit doch nur ein Verstummen der
"wilden, autonomen, widerspenstigen, unkontrollierten Ursprünge
moralischer Urteilskraft." Indes, ein konsequenter Relativismus, der die
Gleich-Gültigkeit kulturspezifischer Moralen, ja, lokalen Brauchtums
propagiert, ist nicht die Alternative zum europäisch-rationalistischen
Universalismus; da die Vielfalt an Moralen sich widersprechen, gar
neutralisieren können, führt er letztlich in die moralische Beliebigkeit, den
Nihilismus. 6.)
Moral ist also nicht relativ. Dies sind nur die verschiedenen ethischen Codes,
die versuchen, echte, spontane, natürliche Moralität durch ihre vorgefassten
Normen und Regeln zu ersetzen. Die Moral selbst ist autonom, die heteronomen
Ethiken sind es, die die Utopie eines befreiten, moralisch-autonomen Subjekts
verhindern. 7.)
Moralität ist nicht begründbar. Vielmehr geht sie allen Begründungsversuchen
voraus, steht auch gar nicht unter Begründungszwang. Sie geschieht einfach –
oder nicht – ex nihilo. Auch erfordert sie keine Überwindung, kein Absehen
vom Eigensinn, keinen Widerspruch zur menschlichen Natur, kein kaltes Kalkül.
Sie ist da. 8.)
Moralität ist das Erwachen der Verantwortung für den Anderen. Erst im Blick
des Anderen erkenne ich mich selbst ganz, und damit zugleich als moralisches
Selbst. Die wahre Autonomie, als Abgrenzung vom Anderen, ist nur durch die
Hinwendung zu einem konkreten Anderen möglich, kein Subjekt ohne Objekt. "Ich
bin ich, insoweit ich für den anderen bin...Verantwortung, die übernommen
wird, als ob sie immer schon da war, ist die einzige Begründung, welche die
Moral haben kann." (Bauman, S. 121) Diese
Verantwortung zu übernehmen, und damit zu sich selbst zu finden, gelingt
allerdings nicht immer und nicht jedem. Moralität ist nicht unvermeidlich, sie
bleibt eine Chance. (Klaus
Goergen) M18
Quellen der Postmoderne M19
"Giebt es auf Erden ein Maaß?" (von
Klaus Podak) Die
Kirchen hielten und halten erfindungsreich an der alten, Jahrhunderte lang bewährten
obersten Autorität
fest. Doch die Kirchen selbst haben ihre absolute Autorität verloren. Und außerhalb
der Kirchen ist der Gott weit in die Ferne entrückt. Autoritätsverlust auch außerhalb
der Kirchen: keine öffentliche Instanz, keine Institution, keine Partei, die
nicht an Reputation verloren hätte, unter Verdacht geraten wäre in der heillos
gewordenen Welt. Es ist nichts grundsätzlich Neues, Verlässliches erfunden
worden. Selbst die nach Wahrheiten suchenden Wissenschaften brauchen neue
Orientierung angesichts ihrer Missbrauchbarkeit, angesichts der hoch riskanten
Konsequenzen ihrer Funde und Erfindungen. Nur – und da liegt die Moral
begraben - außerhalb der Religion hapert es vollständig an einer absoluten,
Halt gebenden Autorität.
Es müsste, wenn an der alten Vorstellung festgehalten wird, eine Autorität
sein, die Zwang ausüben und Sanktionen verhängen kann. [...] Die
letzten ernst zu nehmenden Kandidaten einer solchen Moral waren in der jüngsten
Geschichte Vernunft
und Sprache:
menschliche Vermögen, die aber doch nicht so recht moralisch zwingen können.
[...] Trotz scharfsinnigster
Argumentation in den Werken von Immanuel Kant (Vernunftethik) und Jürgen
Habermas (auf Sprache
gegründete Diskursethik) haben sich diese Begründungsversuche nicht allgemein
durchsetzen können. Der moralische Zwangscharakter von Vernunft und Sprache
wird von keiner größeren Gruppe der Gesellschaft akzeptiert.
Er wird höchstens dann behauptet und benutzt, wenn es um die Überführung
anderer als Abweichler vom
Pfad der Tugend geht. Das Model einer am biblischen Schema orientierten Moral,
die mit Autorität und Strafen operiert, ist in der hochkomplexen Gesellschaft
der Moderne nicht mehr durchzusetzen, geschweige denn verbindlich durchzuhalten. Die
Gesellschaft reagiert einfach antiautoritär. Die biblisch-abendländische
Moralvorstellung mitsamt ihren Nachfolgern
im Geiste ist in einem Dilemma gelandet, das offenbar mit Allgemeinheitsansprüchen
nicht mehr aufzulösen
ist. [...] Eine
endgültige Moral aus absoluter Begründung? Der Traum ist wohl ausgeträumt.
Trotzdem wird kaum jemand bestreiten, dass wir z.B. auf das Konzept der
Menschenrechte zur Orientierung angewiesen sind; dass wir Moral in irgendeiner
Form brauchen, um uns im Zusammenleben zurechtzufinden. Aber wie können wir das
jetzt noch hinkriegen? [...] Die philosophisch rein und sauber gehaltenen Begründungsversuche
umfassender Ethiken erreichen die durch gebrochene Traditionen gekennzeichnete,
von Menschen chaotisch in Unordnung gebrachte Wirklichkeit nicht mehr. Ein
neuartiger Umgang mit Moral, der mit solchen, gleichsam verschmutzten Verhältnissen
rechnet, ist an der Zeit. Moral
muss nämlich gar nicht von einem Nullpunkt aus begründet und dann in die
Gesellschaft eingeführt
werden. Sie liegt in zerstückelten Teilen immer schon vor. Jeder weiß durch
seine Sozialisation
ungefähr, was dort, wo er lebt, für gut und für böse, für gerecht und für
ungerecht im Umgang
mit anderen Menschen gehalten wird. Dabei ist es erst einmal gleichgültig, ob
sich der einzelne an diese, ihm irgendwie eingepflanzten, Regeln hält. Denn er
weiß, wie andere Mitglieder der Gesellschaft sein Handeln bewerten, diese
Bewertung ausdrücken und spürbar machen werden. Er kennt auch Reinheitsgebote
der Flickwerkmoral – und reagiert darauf: mit Anpassung oder mit Auflehnung. Die
Menschen kombinieren
aus diesen
Beständen, basteln sich daraus Patchwork-Ethiken,
die im Alltag ein Durchkommen möglich machen. Alle diese vorläufigen
Regelkombinationen zwingen nicht wirklich, aber sie erlauben es, die Handlungen
anderer und die Folgen der eigenen abzuschätzen und einzuordnen. (Aus:
Süddeutsche Zeitung, 23. 04. 2000, SZ an Ostern) Aufgaben: 1.
"Eine endgültige Moral aus absoluter Begründung" könne es nicht
mehr geben, behauptet der Text. 2.
Warum wird dieser Verlust überhaupt zu einem Problem? 3.
Welchen Ausweg beschreibt der Text? 4.
Suchen Sie in Ihrer eigenen Erfahrungswelt nach Beispielen für den Verlust von
Autoritäten. 5.
Der Text spricht von einer "Flickwerkmoral" – was kann man sich
konkret darunter vorstellen? M20
Zigmunt Bauman: Postmoderne Moralbegründung (Z.
Bauman, Postmoderne Ethik, Hamburg 1995, S. 108ff.) Die
lange Suche nach gesicherten Begründungen moralischen Verhaltens dreht sich
hier im Kreise. Den a priori
als launisch
und sprunghaft deklarierten Gefühlen mißtrauend, setzten die Begründungssucher
auf die rationalen
Entscheidungsträger, die sie aus dem Gehäuse der irreführenden Gefühle
herauszuholen gedachten.
Diese Verlagerung des Schwerpunktes sollte ein Akt der Befreiung sein; den Gefühlen
zu folgen, wurde
als Unfreiheit definiert (was immer jemand trotz und sogar gegen jede Vernunft
tat, mußte die Folge eines
Zwanges sein, der sich über jedes Argument hinwegzusetzen vermochte), und
konsequenterweise kam die
Emanzipation damit einem Austausch gleich: an die Stelle der Abhängigkeit des
Handelns von Gefühlen trat
die Abhängigkeit des Handelns von Vernunft. Vernunft ist definitionsgemäß
regelgeleitet; vernünftig zu handeln,
bedeutet demnach, bestimmten Regeln zu folgen. Freiheit, das Wesenszeichen eines
moralischen Selbst,
wurde nun an der Genauigkeit gemessen, mit der es Regeln befolgte. Am Ende ist
das moralische Subjekt
aus den Banden autonomer Gefühle gehakt worden, nur um in das Geschirr
heteronomer Regeln eingespannt
zu werden.[...] Verantwortung
beschwört das Antlitz herauf, dem ich mich zuwende, aber sie erschafft mich
auch als moralisches
Selbst. Verantwortung zu übernehmen, als sei ich bereits verantwortlich
gewesen, ist ein Akt der
Erschaffung des moralischen Raums, der nicht anderweitig oder anderswo plaziert
werden kann. Diese Verantwortung,
die übernommen wird, als ob sie immer schon da war, ist die einzige Begründung,
welche die
Moral haben kann. Eine zerbrechlich-zarte Begründung, muß man zugeben. [...] Es
ist diese Verantwortlichkeit - höchste, vollständig nicht-heteronome
Verantwortlichkeit, radikal unterschieden
von der Verantwortung auf Geheiß oder von Verpflichtungen aus einem Vertrag -
die mich zum
Ich macht. Diese Verantwortung stammt von nichts anderem ab. Ich bin
verantwortlich nicht wegen meines
Wissens um den Anderen, wegen seiner Tugenden oder wegen der Dinge, die er getan
hat und die er mir
oder für mich tun könnte. Es obliegt nicht dem Anderen, mir zu beweisen, daß
ich ihm meine Verantwortung
schulde. Nur in dieser kräftigen und stolzen Zurückweisung des Grund-,
des Begründunghabem macht
mich Verantwortung frei. Diese Emanzipation ist nicht vergiftet von
Unterordnung, selbst wenn
sie darin resultiert, daß ich mich selbst als eine Geisel dem Wohl und Wehe des
Anderen ergebe. Ambivalenz
liegt im Kern der Moral: Ich bin frei, insoweit ich eine Geisel bin. Ich bin
ich, insoweit ich für den
Anderen bin. Erst wenn diese Ambivalenz übertapeziert oder aus der Sicht
verbannt wird, kann Egoismus
gegen Altruismus, Eigeninteresse gegen Gemeinwohl, moralisches Selbst gegen
gesellschaftlich gebilligte
ethische Normen gesetzt werden. Aufgaben: 1.
Was wirft Bauman bisherigen Moralbegründungen vor? Gegen welche Begründungen
wendet er sich? 2.
Wie begründet er selbst moralisches Verhalten? 3.
"Ich bin frei, insoweit ich eine Geisel bin." – Wie ist dieser
Widerspruch zu verstehen? M21
Zigmunt Bauman: Postmoderne Ethikkritik (Aus:
Z. Bauman, Postmoderne Ethik, Hamburg 1995, S. 23 f.) Ich
denke, folgende Merkmale kennzeichnen die moralische Verfassung aus postmoderner
Sicht: I.
Die Behauptungen (sich widersprechend, aber allzuoft mit gleicher Überzeugungskraft
vertreten) "Menschen sind
ihrem Wesen nach gut, man muß ihnen nur helfen, sich ihrer Natur gemäß zu
verhalten" und "Menschen sind ihrem Wesen nach böse, man muß sie
davor bewahren, ihren Impulsen zu folgen" sind beide falsch. Tatsächlich
sind Menschen moralisch ambivalent: Ambivalenz wohnt im Kern der "Primärszene",
des menschlichen von Angesicht-zu-Angesicht. Alle nachfolgenden sozialen
Arrangements - von macht-gestützten Institutionen bis zu rational artikulierten
und ermessenen Regeln und Pflichten - setzen diese Ambivalenz als ihren
Grundstoff ein, während sie alles tun, sie von ihrer Erbsünde, nämlich
Ambivalenz zu sein, zu reinigen. Diese Anstrengungen aber sind entweder
ineffektiv oder sie verschlimmern das Übel, das sie entschärfen wollen.
Angesichts der primären Struktur menschlichen Zusammenseins ist eine
nicht-ambivalente Moralität eine existentielle Unmöglichkeit. Kein logisch kohärenter
ethischer Code kann der essentiell ambivalenten Verfassung von Moralität Genüge
tun. Und auch Rationalität kann moralische Impulse nicht außer Kraft setzen;
sie kann sie höchstens ruhigstellen und lähmen, deshalb aber die Chancen, daß
das Gute getan wird, nicht erhöhen, vielleicht sogar vergleichsweise nur
verringern. Daraus folgt, daß es keine Garantien für moralisches Verhalten
gibt; weder durch besser gestaltete Handlungskontexte noch durch bessere
Handlungsmotive. Wir müssen lernen, ohne solche Garantien zu leben und mit dem
Bewußtsein, daß es sie auch nie geben wird - daß eine perfekte Gesellschaft
ebenso wie ein perfektes menschliches Wesen keine realisierbare Aussicht
darstellen und Versuche, das Gegenteil zu beweisen, zu größerer Grausamkeit
als zu mehr Menschlichkeit - und sicherlich zu weniger Moralität - führen. 2.
Moralische Phänomene sind [...] nicht-rational.
Da sie nur
dann moralisch sind, wenn sie jeglichen Zwecküberlegungen
und Gewinn-/Verlustrechnungen vorausgehen, passen sie nicht ins
Zweck-Mittel-Schema. Sie
entziehen sich auch den Begriffen von Brauchbarkeit oder Dienst, den sie einem
moralischen Subjekt, einer Gruppe
oder einer Sache erweisen oder erweisen könnten. Sie sind nicht so gleichförmig,
wiederkehrend, monoton und vorhersagbar, daß sie als regelgeleitet darstellbar wären. Vor allem deshalb können sie nicht
durch irgendeinen ethischen Code erschöpfend erfaßt werden. Ethik wird nach
dem Muster des Rechts gedacht; wie dieses bemüht sich Ethik da, wo sie einen
Standpunkt bezieht, um Definitionen für angemessenes und unangemessenes
Handeln. Sie setzt sich selbst das Ideal (das kaum je in der Praxis erreicht
wird), erschöpfende und
unzweideutige Definitionen hervorzubringen; solche, die klare Regeln für die
Wahl zwischen angemessen und unangemessen liefern und keine "Grauzone« der
Ambivalenz und Mehrfachinterpretation lassen. Mit anderen Worten: Ethik geht von
der Annahme aus, in jeder Lebenssituation könne und solle eine Wahl als die
eine gute im Gegensatz zu zahlreichen schlechten dekretiert werden. Handeln kann
demzufolge in jeder Situation rational sein - nämlich so, wie die Handelnden es
auch sein sollten. Doch diese Annahme unterschlägt, was an der Moralität
eigentlich moralisch ist. Sie verschiebt moralische Phänomene aus dem Bereich
der persönlichen Autonomie in den machtgestützter Heteronomie. Sie setzt
erlernbares Wissen um Regeln an die Stelle eines moralischen Selbst, das sich
durch Verantwortung konstituiert. Sie setzt Verantwortlichkeit gegenüber den
Gesetzgebern und –hütern des Codes an die Stelle, an der früher
Verantwortlichkeit gegenüber dem Anderen und dem eigenen moralischen Gewissen
bestand - als dem Kontext, in dem moralische Position bezogen wird. Aufgaben: 1.
Inwiefern sind Menschen "moralisch ambivalent"? Inwiefern ist Moral
"nicht rational"? Versuchen Sie, 2.
Suchen Sie Beispiele menschlichen Handelns, an denen sich die Kritik Baumans
belegen lässt. 3.
Was könnte man gegen Baumans Vorwürfe kritisch einwenden? M22
Richard Rorty: Zur Beförderung der 'Menschenrechtskultur' (R.
Rorty, Wahrheit und Fortschritt, Frankfurt/M. 2000, S. 258 f.) Nach
Platons Ansicht kann man die Menschen dazu bringen netter zueinander zu sein,
indem man sie auf eine Eigenschaft hinweist, die allen gemeinsam ist: ihre
Vernunft. Es nutzt aber wenig, wenn man die eben geschilderten Leute darauf
aufmerksam macht, daß viele Muslime und viele Frauen eine Menge von Mathematik,
Technik oder Jura verstehen. Die aufgebrachten jungen Nazischläger waren sich
durchaus im klaren darüber, daß es viele kluge und gebildete Juden gab, doch
das hat nur das Vergnügen gesteigert, mit dem sie solche Juden verprügelten.
Es nutzt auch nicht viel, solche Leute dazu zu bringen, Kant zu lesen und
zuzustimmen, daß man handelnde Vernunftwesen nicht als bloße Mittel behandeln
sollte. Denn alles hängt davon ab, wer überhaupt als Mitmensch gilt: als
handelndes Vernunftwesen im einzig relevanten Sinne, nämlich in dem Sinne, in
dem vernünftiges Handeln gleichbedeutend ist mit der Zugehörigkeit des
Betreffenden zu unserer moralischen Gemeinschaft. Die
meisten Weißen waren bis vor ganz kurzer Zeit der Ansicht, daß die meisten
Schwarzen nicht dazugehörten. Die meisten Christen waren bis ins 17.
Jahrhundert etwa der Ansicht, daß die meisten Heiden nicht dazugehörten. Nach
Ansicht der Nationalsozialisten gehörten die Juden nicht dazu. Nach Ansicht der
meisten Männer in Ländern mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen unter
dreitausend Euro gehören die meisten Frauen auch heute noch nicht dazu. Immer,
wenn Rivalitäten zwischen Stämmen und Völkern wichtig werden, werden die
Angehörigen der gegnerischen Stämme und Völker nicht dazugehören. Aus Kants
Erklärung der gebührenden Achtung vor handelnden Vernunftwesen geht hervor, daß
man die Achtung,
die man vor Personen der eigenen Art empfindet, auf alle ungefiederten Zweifüßer
übertragen sollte. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag, eine gute Formel zur
Verweltlichung der christlichen Lehre von der Brüderlichkeit der Menschen. Doch
bisher ist dieser Vorschlag noch nie durch ein auf neutralen Prämissen
beruhendes Argument begründet worden, und dies wird auch in Zukunft nicht
gelingen. Außerhalb des europäischen Kulturkreises der Nachaufklärungszeit -
also außerhalb des Kreises der verhältnismäßig ungefährdeten und geborgenen
Personen, die seit zwei Jahrhunderten wechselseitig ihre Empfindungen
manipulieren - sind die meisten Leute einfach außerstande zu begreifen, wieso
die Zugehörigkeit zu einer biologischen Spezies ausreichen soll, um einer
moralischen Gemeinschaft zugerechnet zu werden. Das liegt nicht daran, dass sie
nicht vernünftig genug sind, sondern im Regelfall liegt es daran, daß sie in
einer Welt leben, in der es schlicht zu riskant, ja häufig
irrsinnig gefährlich wäre, den Sinn für die moralische Gemeinschaft so weit
zu fassen, daß er über die eigene Familie, die eigene Sippe oder den eigenen
Stamm hinausreicht. Um
dafür zu sorgen, daß die Weißen netter zu den Schwarzen sind, die Männer
netter zu den Frauen, die Serben netter zu den Muslimen oder die Heterosexuellen
netter zu den Homosexuellen, und um dazu beizutragen, daß sich unsere Spezies
zu der von einer Menschenrechtskultur dominierten "planetarischen
Gemeinschaft" verbindet, nutzt es gar nichts, im Anschluss an Kant zu
sagen: Erkennt, daß das, was euch gemeinsam ist - eure Menschlichkeit -
wichtiger ist als diese belanglosen Unterschiede. Denn die Leute, die wir zu überreden
versuchen, werden erwidern, daß sie nichts dergleichen erkennen. Solche Leute fühlen
sich moralisch gekränkt, wenn man vorschlägt, sie sollten jemanden, mit dem
sie nicht verwandt sind, wie einen Bruder behandeln, einen Nigger wie einen Weißen,
einen Schwulen wie einen Normalen oder eine Gottlose wie eine Gläubige. Was sie
kränkt, ist das Ansinnen, sie sollten Leute, die nach ihrer Auffassung keine
Menschen sind, wie Menschen behandeln. [...] Nach Ansicht der Anhänger des
Fundierungsgedankens sind diese Leute insofern benachteiligt, als es ihnen an
Wahrheit und moralischem Wissen gebricht. Es wäre jedoch besser - konkreter,
spezifischer und aufschlussreicher im Hinblick auf mögliche Abhilfe -, wenn man
sie insofern als benachteiligt
ansähe, als es ihnen an zwei konkreteren Dingen mangelt: Geborgenheit und
Mitgefühl. Unter 'Geborgenheit' verstehe ich Lebensbedingungen, die derart
risikofrei sind, daß die eigene Verschiedenheit von anderen unerheblich ist für
die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl. In den Genuss dieser Bedingungen sind
Amerikaner und Europäer - also diejenigen, die den Gedanken der
Menschenrechtskultur ersonnen haben - bisher in weit höherem Maße gekommen als
irgend jemand sonst. Unter 'Mitgefühl' verstehe ich Reaktionen derart, wie sie
bei den Athenern nach dem Besuch der "Perser" des Aischylos weiter
verbreitet waren als vorher und wie sie bei den weißen Amerikanern nach der
Lektüre von "Onkel Toms Hütte" weiter verbreitet waren als vorher.
Es sind Reaktionen, wie sie bei uns weiter verbreitet sind, nachdem wir
Fernsehprogramme über den Völkermord in Bosnien gesehen haben. Geborgenheit
und Mitgefühl gehen miteinander einher, und zwar aus denselben Gründen, aus
denen Frieden und wirtschaftliche Produktivität miteinander einhergehen. Je
schwieriger die Verhältnisse, je größer die Anzahl der
furchterregenden Umstände, je gefährlicher die Situation, desto weniger kann
man die Zeit oder die Mühe erübrigen, um darüber nachzudenken, wie es
denjenigen ergehen mag, mit denen man sich nicht ohne weiteres identifiziert.
Die Schule der Empfindsamkeit und des Mitgefühls funktioniert nur bei Leuten,
die es sich lange genug bequem machen können, um zuzuhören. Aufgaben: 1.
Was hilft, nach Meinung Rortys, zur Beförderung der Menschenrechtskultur- und
was hilft nicht? 2.
Wieso kann der Appell an Menschenrechte eine moralische Zumutung sein? 3.
Was hat Mitgefühl mit Geborgenheit zu tun? Erläutern Sie, welchen Zusammenhang
Rorty sieht? 4.
"Onkel Toms Hütte" statt Kant – wie beurteilen Sie diese
Alternative? 5.
Wo sehen Sie Gefahren, wenn moralisches Verhalten sich auf – durch Medien
erzeugtes – Mitgefühl gründet? M23
Kritische Fragen zur Postmoderne 1.
Beruht die gegenwärtige Faszination der Postmodernen nicht nur darauf, dass sie
den Zeitgeist moderner
Dienstleistungsgesellschaften und das Lebensgefühl des hedonistischen Teils
deren Bildungsbürgertums
genau trifft und spiegelt, deren politische und ästhetische Präferenzen
formuliert und ein illusions-, prinzipien- und orientierungsloses Dasein
philosophisch legitimiert und überhöht? Stellt sie mithin nur eine willkommene
Modeerscheinung ohne Anspruch auf dauerhafte Einsichten dar, eine bequeme
Philosophie für "Bobos"? 2.
Ist das, was die Postmoderne als soziale und ideologische Basis für ihre
philosophischen Ableitungen reklamiert - multikulturelle und –morale, offene
und plurale Gesellschaften, die zu keinerlei Einheit mehr finden können –
letztlich nicht nur eine "neue Unübersichtlichkeit" (Habermas) die
mit Hilfe ordnender Vernunft, klarer Begriffe und aufklärerischer Gesinnung
sich wieder in neue, höhere Ordnung und Einheit auflösen ließe? 3.
Bleibt die Forderung nach einer "Hinwendung zum Anderen", die Idee,
dass erst in der Selbst- Losigkeit
das Selbst gefunden werden kann, nicht letztlich eine religiös fundierte
Utopie, der die bescheidenere
Forderung nach einer "Einbeziehung des Anderen" (Habermas) in unser
Denken und Handeln,
z.B. durch einen freien, auf Konsens gerichteten Diskurs, entgegen gehalten
werden kann? 4.
Ist das Bestreiten universalen Geltungsanspruchs von Moral, insbesondere die
Kritik an euro-päischer Menschenrechtstradition nicht zum einen leichtfertig da
sie als Plazet zu moralischer Unverbindlichkeit und Beliebigkeit (miss)verstanden
werden kann, die schließlich jeden und alles moralisch rechtfertigt, zum
anderen gefährlich in einer Zeit, in der das Selbstverständnis des Menschen
durch Genforschung, Medizin und Mikroelektronik permanent in Frage gestellt wird
und daher das Bedürfnis nach moralischen Gewissheiten groß ist, wie selten? 5.
Hat die Ethik der Moral wirklich die Unschuld geraubt, sie mit schlangenhafter
Vernünftelei aus dem Paradies der Spontaneität gelockt, in das unter noch so
großer Anstrengung der Begriffe und Appelle kein Weg zurück führt – oder
ist Moralität nicht doch erwerbbar, einsichtig, ein Lernprozess bei Mensch und
Menschheit? 6.
Kann das Florett der Vernunftkritik das Schwert der kritischen Vernunft
ersetzen? Aufgaben: 1.
Welche dieser Fragen würden Sie mit 'ja', welche mit 'nein' beantworten? Begründen
Sie Ihre Zustimmung
oder Ablehnung der Kritik an der Postmodernen. 2.
Welchen dieser kritischen Einwände gegen die Postmoderne halten Sie für den stärksten, welchen
für den schwächsten? Begründen Sie Ihre Einschätzung. 3.
Was bleibt, trotz dieser Kritik, richtig an den Behauptungen postmoderner Ethik?
Diskutieren Sie
die bleibenden Verdienste postmoderner Ethik. M24
Brainwriting zu moralischen Gefühlen Aufgaben: 2.
Reichen Sie Ihr Arbeitsblatt dann im Uhrzeigersinn an ein Gruppenmitglied
weiter. 3.
Tragen Sie auf dem Arbeitsblatt, das Sie nun erhalten, in der zweiten Linie in
jede Spalte weitere 4.
Die Arbeitsblätter werden nun so lange weitergegeben, bis alle Felder ausgefüllt
sind. 5.
Vergleichen Sie die Blätter in Ihrer Gruppe und streichen Sie doppelte Wörter. 6.
Übertragen Sie die übriggebliebenen Wörter auf Ihr Gruppenblatt.
M25
Ein Alphabet moralischer Gefühle Anerkennung Anteilnahme Bedauern Begeisterung Betroffenheit Bewunderung Billigung Dankbarkeit Empörung Entrüstung Erbitterung Ergriffenheit Freude Gekränktheit Genugtuung Gewissensbisse Gewissensnot Gram gutes
Gewissen Missbilligung Mitgefühl Mitleid Pflichtgefühl Ressentiment Reue Rührung Scham Schuldgefühl Selbstwertgefühl Sorge Stolz Trauer Unmut Verachtung Verantwortungsgefühl Verehrung Verzweiflung Wertschätzung Zerknirschung Zufriedenheit Aufgabe: Ordnen
Sie die moralischen Gefühle
in das Modell der 'Arten moralischer
Gefühle' ein. Falls
möglich, gliedern Sie dabei die
einzelnen Gefühle nach ihrer Intensität. M26
Arten moralischer Gefühle
1
Cicero,
De officiis, III, 37. 2
H.A. Prichard,
Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum? in: K. Bayertz, Hg., Warum
moralisch sein?, vgl. Anm. 3, S. 49-68. 3 Kurt
Bayertz, Hg, Warum moralisch sein? Paderborn 2002, (Einleitung) S. 19. 4
Tilman Moser,
Gottesvergiftung, Frankfurt a. M. 1977, S. 6. 5
Friedrich
Nietzsche, Der tolle Mensch (Aph. 125) in: Die fröhliche Wissenschaft, KSA 3,
S. 480f. 6
John Stuart Mill,
Der Utilitarismus, Stuttgart 1986, S. 66. 7
Hans Krämer,
Integrative Ethik, Frankfurt a. M. 8
Vgl. Dieter Henrich,
Die Deduktion des Sittengesetzes. Über die Gründe der Dunkelheit des letzten
Abschnitts von Kants 'Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten', in: A. Schwan, Hg., Denken im Schatten des
Nihilismus, Darmstadt 1975, S. 55-112. 9
Vgl. Hans Krämer,
Integrative Ethik, Frankfurt a. M. S. 12-18. 10
Arthur
Schopenhauer, Metaphysik der Sitten, München 1985, S. 222. 11
Konrad Ott,
Moralbegründungen, Hamburg 2001, S. 93. 12
Harald Schmitz, was
wollte Kant?, Bonn 1989, zit. nach: O. Höffe, Kants Kritik der reinen Vernunft,
München 2003, S. 298. 13
Max Scheler,
Grammatik der Gefühle, München 2000, S. 155. 14
J. Habermas,
Diskursethik. Notizen zu einem Begründungsprogramm, in: Moralbewusstsein und
kommunikatives Handeln,
Frankfurt a. M. 1992, S. 77. 15
J. Habermas, Die
Einbeziehung des Anderen, Frankfurt a. M. 1996, S. 51. 16
Vgl. Ernst
Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt a. M. 1993, S. 161 ff. 17
Vgl. J. F. Lyotard,
Das postmoderne Wissen, Wien 1999, S. 60 ff. 18
J. Habermas, Die
Einbeziehung des Anderen, aaO. S. 51 19
J. Habermas,
Faktizität und Geltung, Frankfurt a.M. 1992, S. 148. 20
Richard Rorty,
Wahrheit und Fortschritt, Frankfurt a.M. 2000, S. 105. 21
Richard Rorty,
Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt a. M. 1989, S. 50. 22
R. Rorty, Wahrheit
und Fortschritt, Frankfurt a. M. S. 242. 23
Ebd. S. 260. 24
Vgl. zum Folgenden:
Z. Bauman, Postmoderne Ethik, Hamburg 1995, S. 9-30. 25
Ebd. S. 22. 26
Ebd. S. 121.
|